Wo sich heute in der Unteren Königstraße das Modegeschäft Peek & Cloppenburg befindet, fand in den Jahren ab 1819 eine der erfolgreichsten Kunstausstellungen statt, die Stuttgart jemals gesehen hat. Zwischen 10.000 und 18.000 Besucher:innen sollen schon in den ersten fünf Monaten in den früheren Offizierspavillon gekommen sein – bei kaum mehr als 30.000 Einwohner:innen.
216 Gemälde hatten damals die Brüder Sulpiz und Melchior Boisseré aus säkularisierten Kölner Kirchen zusammengetragen. Der württembergische König Wilhelm I. wollte die Sammlung erwerben, deshalb kam sie nach Stuttgart. Doch der Landtag spielte nicht mit. So erhielt Bayernkönig Ludwig II. den Zuschlag und die Sammlung wurde zum Grundstock der Alten Pinakothek München. Daraufhin gründeten führende Bürger der Stadt einen Kunstverein, der noch im selben Jahr, 1827, in den Offizierspavillon einzog.
In zwei Jahren wird der Württembergische Kunstverein (WKV) also 200 Jahre alt. Hans D. Christ und Iris Dressler, die Direktor:innen, haben jetzt schon angefangen, sich darauf vorzubereiten, und zwar vor aller Augen. "Konstellation 1" nennen sie, was jetzt als erstes Ergebnis der Sichtung ihres Archivs und eigener Recherchen im Vierecksaal des WKV ausgestellt ist. Zunehmend sollen auch Künstler:innen mitmachen. Christ und Dressler wollen nicht nur die Geschichte aufarbeiten, einschließlich der problematischen Aspekte, sondern erhoffen sich grundlegende Erkenntnisse zur Selbstorganisation der bürgerlichen Gesellschaft.
Kunstvereine waren Aktiengesellschaften: Mitglieder erwarben Aktien im Wert von fünfeinhalb Gulden. Vom Kapital, das auf diese Weise zusammenkam, kaufte der Verein Kunst, die ausgestellt und alle drei Jahre per Losverfahren an die Mitglieder verteilt wurde. So entstand eine Gemeinschaft von durchweg männlichen Künstlern, Sammlern und Kennern, von der immer wieder wichtige Impulse für die Gesellschaft ausgingen, wie etwa die verlegerische Tätigkeit des Gründungsmitglieds Johann Friedrich Cotta beweist, des "Bonaparte unter den Buchhändlern", wie er auch genannt wurde.






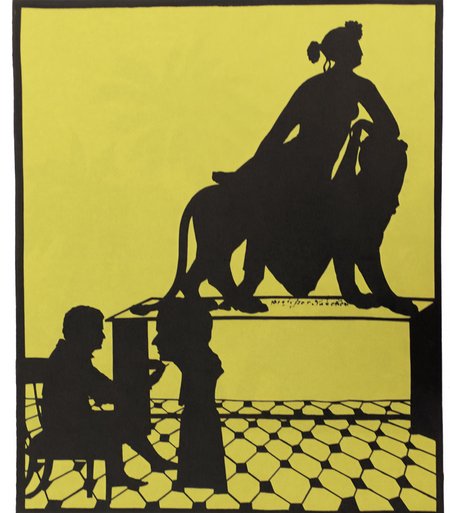



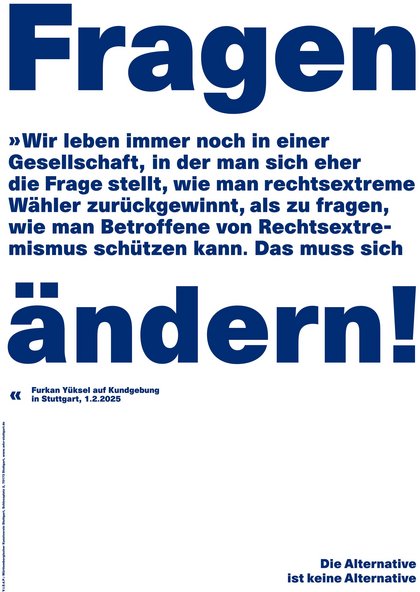


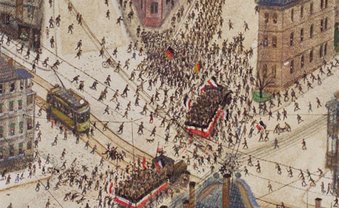
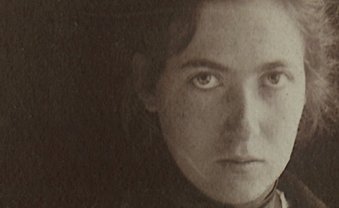















0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!