Es ist der Ostersonntag im Libanon. Dieses Jahr feiern die mehr als zehn christlichen Konfessionen im Land zusammen. In den Restaurants meiner Heimatregion im Süden sitzen zur Mittagszeit christliche Familien und muslimische Gäste beisammen. Die Stimmung ist festlich – obwohl die Zerstörung des Krieges nur wenige Kilometer entfernt liegt. Plötzlich hallen Explosionsgeräusche aus der Ferne. Die Musik wird lauter gestellt, um die Gäste abzulenken. Für sie ist das Alltag.
Krisen im Libanon
1943: Unabhängigkeit vom französischen Mandat, Libanon wird souveräner Staat mit konfessioneller Machtverteilung.
1948: Erste Destabilisierung durch palästinensische Geflüchtete. Nach Gründung Israels fliehen Zehntausende Palästinenser in den Libanon.
1969 bis 1971: "Cairo Agreement": Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) erhält das Recht, von libanesischem Boden gegen Israel zu operieren.
1975: Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen christlichen Milizen und muslimischen Linken (unterstützt von der PLO).
1982: Israelische Invasion, Besetzung des Südlibanons. PLO wird vertrieben.
1989/90: Ende des Bürgerkriegs. Friedensvertrag bringt Syrien faktisch die Kontrolle über das Land. Die Christen verlieren an Macht.
2000: Israelischer Rückzug aus dem Südlibanon nach 18 Jahren Besatzung. Hisbollah erklärt den "Widerstandssieg".
2005: Mord an Premierminister Rafik Hariri, Proteste gegen Syrien (Zedernrevolution), Abzug der syrischen Truppen.
2006: 33-tägiger Krieg zwischen Hisbollah und Israel. Hisbollah ist wieder Sieger und bleibt im Süden. UN-Friedenskräfte UNIFIL verstärkt.
2011: Syrienkrieg und massive Flüchtlingswelle. Über 1,5 Millionen syrische Geflüchtete belasten Libanons fragile Lage.
2019: Finanzkollaps und landesweite Proteste. Banken frieren Guthaben ein, die Bevölkerung demonstriert gegen Korruption, ohne Erfolg.
2020: Explosion im Hafen von Beirut. 218 Tote, Tausende Verletzte, massive Verwüstung in der Hauptstadt.
2021 bis heute: Sozialer Zerfall und Hyperinflation, Grundversorgung bricht zusammen. NGOs übernehmen viele Aufgaben des Staates.
2023: Wiederholte Gefechte im Süden Eskalationen zwischen Hisbollah und israelischer Armee.
2024: Israel bombardiert Hisbollah-Ziele. Angriffe betreffen nicht nur den Süden, sondern auch Vororte von Beirut. Zivile Infrastruktur wird stark beschädigt. Hisbollah-Spitze ist eliminiert. (ses)












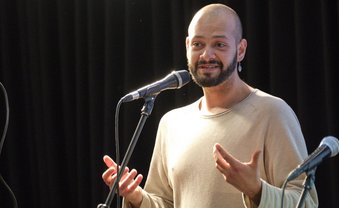



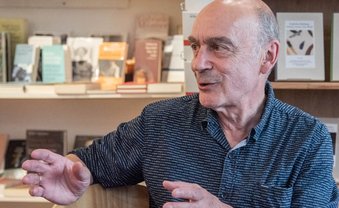









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!