Herr Paech, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will Wachstum und Ökologie verbinden, und auch den Grünen auf Bundesebene gilt das als Gebot der Stunde. Geht diese Rechnung auf?
Seit Beginn der Industrieproduktion gab es noch kein Beispiel dafür, dass es durch technische Maßnahmen, also Effizienzsteigerung, Kreislaufwirtschaft oder regenerative Energie, gelungen wäre, wirtschaftliches Wachstum ökologisch verträglich zu gestalten. Dies ist weder theoretisch darstellbar, noch in der Realität jemals geglückt. Die deutsche Energiewende, die sich ja auch die Partei von Herrn Kretschmann als Erfolg anrechnet – das EEG, das 100 000-Dächer-Programm für Solaranlagen und die Förderung energiesparenden Bauens und Sanierens über die KfW – ist ein Fanal der Fortschrittsnaivität. Sie hat viele Natur- und Kulturareale, die uns noch geblieben sind, durch den Hebel, es diene ja dem Klimaschutz, verfügbar gemacht für eine industrielle Verwertung. Ohne dass dadurch die CO2-Emissionen merklich gesunken wären.
Sie meinen Solaranlagen auf den Feldern?
Windkraft, Freiflächen-Solaranlagen, aber auch Bioenergie: Maisfelder noch und noch in Norddeutschland und in den nordöstlichen neuen Bundesländern. Herr Kretschmann hat recht, dass man damit das Wachstum anheizt und Wohlstand schafft: Viele Menschen sind reich geworden durch die Energiewende, weil sie ein gigantisches Umverteilungsprogramm darstellt. Wer Geld hatte, konnte es vermehren. Wer weniger Geld hat, zahlt mehr für Strom. Das würde ich sogar akzeptieren, wenn damit die Ökosphäre entlastet würde. Aber tatsächlich wurden damit letzte Reste der deutschen Naturlandschaft in eine Beute umgewandelt. In allen anderen Bereichen – ob wir über Kunststoffabfälle reden, über Elektroschrott oder Flächenversiegelung, das Insektensterben, das Singvogelsterben: Nirgendwo ist durch Technik eine Entlastung erreicht worden. Die Probleme potenzieren sich, und zugleich die Versuche, Effizienz, Kreislaufwirtschaft oder regenerative Energien so ins Werk zu setzen, damit dieses Wunder, reich zu werden und gleichzeitig die Ökosphäre zu schützen, wahr werden könnte.
Vom Fahrzeugkatalysator angefangen hatte ich eigentlich immer den Verdacht, dass der Schuss nach hinten losgeht.






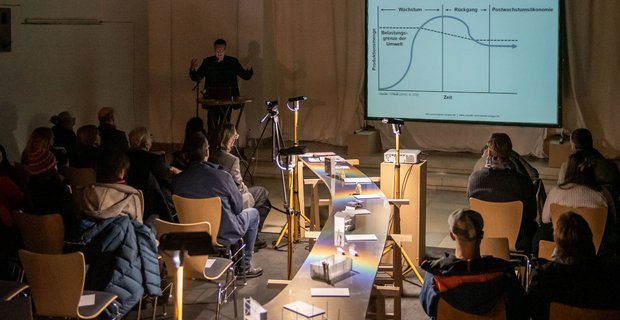
















2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Um die Supermärkte rauszuhalten, muss man nicht mal selber Gemüse anbauen, da reicht schon der Einlauf auf einem der vielen Wochenmärkte, die es zum Glück noch gibt! Hier kauft man - wenn man den richtigen Stand ansteuert - direkt beim Erzeuger und bekommt die Ware problemlos unverpackt, wenn man…
Kommentare anzeigenSusanne Jallow
am