Die Bilder der zigtausend Flüchtenden in Gaza machen sprachlos, hilflos und manche:n wütend. Der Krieg nimmt an Härte zu, immer mehr Staaten wenden sich von Israel ab, mittlerweile erkennen 157 Länder Palästina als Staat an, zuletzt Frankreich. Das will die deutsche Bundesregierung nicht, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erklärte allerdings nach langem Stillschweigen, es sollten keine deutschen Waffen mehr nach Israel geliefert werden, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Die Zerstörung Gazas geht unterdessen unverändert weiter. In Deutschland leben etwa 200.000 Menschen palästinensischer Herkunft und wahrscheinlich ähnlich viele mit jüdischen Wurzeln. Der Dialog zwischen den Gruppen – auch unter Deutschen ohne Migrationshintergrund – über den Krieg wird immer schwieriger. Ist er überhaupt noch möglich? Das hatte sich Kontext gefragt und am 23. September ins Kulturzentrum Merlin eingeladen, um Stuttgarter:innen vorzustellen, die sich genau diesen Dialog zur Aufgabe gemacht haben.
Die vier auf der Bühne kommen aus Israel, aus einem palästinensischen Flüchtlingslager in Syrien oder sind hier geboren, und sie verbindet der Wille. Gemeinsam arbeiten sie in und an Stuttgarter Projekten wie Sukkat Salam (Laubhütte des Friedens), Yad be Yad (Hand in Hand) und im Verein Kubus. Es sei ein schwieriger Weg, zu lernen, die andere Seite ernst zu nehmen, sie wirklich kennenzulernen, berichtet Rachaa Chahade. Weil alle Beteiligten so emotional verstrickt seien. 1985 waren ihre Eltern aus einem libanesischen Flüchtlingslager nach Deutschland geflohen. Sie selbst ist hier geboren, hatte aber lange den Status "staatenlos". Für die deutsche Staatsangehörigkeit sollte sie einen Deutschtest ablegen – "da war ich im Gymnasium in der Oberstufe." Strukturellen Rassismus nennt sie diese Erfahrung mit deutschen Ämtern.
Ahmad Al Saadi hat nach 33 Jahren in Deutschland am 1. Oktober 2023 die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen – sechs Tage danach ermordete die Hamas 1.200 Israelis und verschleppte 251 als Geiseln. Israel schlug zurück – bis heute tobt der Krieg in Gaza. Mittlerweile sollen 65.000 Palästinenser:innen getötet worden sein, von den Geiseln sollen sich nach einigen Freilassungen noch 48 in der Hand der Hamas befinden, wie viele am Leben sind, ist unklar.
Al Saadi kam in einem syrischen Flüchtlingslager zur Welt, in Deutschland galt sein Status lange als "ungeklärt". "Das ist noch weniger als staatenlos", sagt er. So konnte er seinem Kind nicht mal seinen Nachnamen geben. Geändert habe sich das 2016 erst in Stuttgart. "Da hatte ich das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein." Doch nach dem 7. Oktober 2023 habe sich für ihn viel geändert. "Der Generalverdacht gegen Palästinenser und der Druck von vielen Seiten haben bei mir eine Identitätskrise ausgelöst." Er habe lange nachgedacht, erzählt er, und sei zu dem Schluss gekommen: "Mein Erbe ist nicht der Holocaust, mein Erbe ist die Nakba." Seine Stimme bricht, als er das sagt.
Schwer, die eigene Identität zu finden
Oron Haim ist vor neun Jahren über den Bundesfreiwilligendienst nach Deutschland gekommen, hiergeblieben und heute Sozialarbeiter. Er habe ein neues Leben anfangen wollen, erzählt er. Als Jugendlicher habe er in Israel ständig gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Das hätten viele gemacht, "auch schon vor dem 7. Oktober", betont er, denn nicht alle Israelis seien mit dessen Politik einverstanden. Wie Netanjahu und sein teils rechtsextremes Kabinett heute agieren, zeige, was passiert, wenn man Faschisten nichts entgegensetzt, sagt Haim.
Kontext-Moderator Stefan Siller fragt nach Kontakten in die Heimat und was sie von ihren Leuten dort hören. Haim erzählt von einem Besuch bei Verwandten in Israel. Da sei eine Rakete über sie geflogen, er war total erschrocken. "Aber dort ist das normal". Solche Erlebnisse kennt auch Chahade. Sie spricht davon, wie stoisch ihre Verwandten in Ramallah auf den Krieg reagierten, "oder besser: Sie sind abgestumpft". Das sei eine Gemeinsamkeit auf beiden Seiten: "Dieses Gefühl, dein Leben kann jederzeit zu Ende sein."
Der Tänzer Shai Ottolenghi aus Haifa sieht das etwas anders. Seit acht Jahren ist er in Deutschland, tanzt seit zwei Jahren bei Gauthier Dance, der Tanzkompagnie des Stuttgarter Theaterhauses. Seine Eltern leben in Modi’in nahe der Westbank. "Ich denke, meine Familie genießt relativen Frieden, selbst wenn sie Raketen hören. Dann sagen sie sich, es passiert schon nichts. Wir haben Bunker, den Iron Dome, die USA. Wir sind privilegiert im Vergleich zu den Palästinensern."

















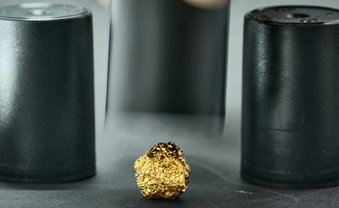


2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
'... es gibt einen krassen Rassismus innerhalb der jüdischen Gesellschaft'
Kommentare anzeigenWaldemar Grytz
am 24.09.2025Eines vorweg: das Judentum ist eine Religion und Kulturgemeinschaft, die Anspruch hat auf staatlichen Schutz und gesellschaftliche Akzeptanz.
Der Zionismus ist aber nicht 'das Judentum', sondern eine sich radikalisierende…