Vor 500 Jahren, 1525, erhoben sich die armen und unfreien Bauern in Süddeutschland, bald schon am Oberrhein, im Elsass, bis Salzburg und Brixen im heutigen Südtirol. Begonnen hatte der "Uffruhr", der Aufschrei nach "Freyheit" und "Gerechtigkeyt" in der Stube der Kramerzunft in Memmingen, wo der Kürschner Sebastian Lotzer und der Prediger Christoph Schappeler die "Zwölf Artikel" des Baltringer, des Allgäuer und des Seehaufens verfassten, in denen zum ersten Mal der rechtlose Stand einer rigiden Klassengesellschaft fordert, "dass wir frei sind und frei sein wollen". Es war, wie es der süddeutsche Historiker Peter Blickle formulierte, "eine verfassungsgebende Versammlung", die den Artikel 1 des Grundgesetzes vorwegnahm: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."
Einiges war so neu 1525, dass es Auswirkungen haben sollte bis heute. Die Bauern konnten nicht lesen und schreiben, bedienten sich aber der damals noch ziemlich neuen Druckerpresse. In wenigen Wochen erschienen die "Zwölf Artikel" in einer damals sensationellen Auflage von 25.000 Exemplaren. Die herrschende Klasse begriff, dass "Pressefreiheit" ein höchst gefährliches Instrument für sie war. Daran hat sich bis heute, vor allem in den Ländern des Globalen Südens, wo Bauern und Arbeiter heute den Aufstand wagen, nichts geändert. Doch auch Erich Fürst von Waldburg-Zeil, Nachfahr des Truchsess von Waldburg, der die aufständischen Bauern vernichtete, hat dies begriffen. Er ist Haupteigentümer der "Schwäbischen Zeitung", die sich selbst "Zeitung für Christliche Kultur und Politik" nennt.
Die Bauern hatten keine Strategie
Wie über den Aufstand in den Jahrhunderten danach, teils bis heute berichtet wird, verschleiert und verfälscht vieles. Schon der Begriff "Bauernkrieg" ist irreführend. Die Bauern führten keinen Krieg. Der Seehaufen am Bodensee zählte zwar 12.000 Mann, sie verschanzten sich in einer Wagenburg, umschlossen das Heer des Truchsess von Waldburg, doch sie hatten keine Strategie. So vernichtete der Truchsess mit den Landsknechten einen Haufen nach dem anderen. Die fürstlichen Kanoniere schossen in die Wagenburg hinein, mehr als 6.000 Bauern wurden bei Frankenhausen zerfetzt. Insgesamt wurden schätzungsweise 70.000 Bauern in allen Schlachten des adligen Heeres getötet.
Es war ein Befreiungskampf von unten, dessen Köpfe Abtrünnige der katholischen Kirche waren, Prediger wie Thomas Müntzer oder Matthias Waibel. Ihr Verständnis von Christentum war eine Gemeinschaft der sozialen Gerechtigkeit. Sie waren der Beginn der Theologie und Pädagogik der Befreiung im Globalen Süden – Vorgänger von Menschen wie Ivan Illich, Augusto Boal, Paulo Freire aus Lateinamerika oder Michel Kayoya aus dem afrikanischen Burundi, der 1972 ermordet wurde.
Gesucht: Bezüge zum Heute
Nach seiner grausamen Niederschlagung kam der "Bauernkrieg" 1525 fast 500 Jahre lang – im Gegensatz zum Bürgertum, der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse – in unserem Geschichtsbewusstsein kaum vor. Und wenn, dann nur als historisches Dekor bei traditionellen Volksfesten mit Landsknechten und Armbrustschützen. Zwar forderte 1834 Georg Büchner im "Hessischen Landboten" "Friede den Hütten, Krieg den Palästen", und wenige Jahre darauf veröffentlichte der Historiker Wilhelm Zimmermann die erste wissenschaftliche Darstellung des Aufstands. Doch an der verbreiteten Unkenntnis über seine Inhalte und Ziele änderte dies wenig. Nun, im Gedenkjahr, scheint der "Bauernkrieg" doch Teil unserer Erinnerungskultur zu werden. Dies heißt, nach Bezügen zum Heute zu suchen.









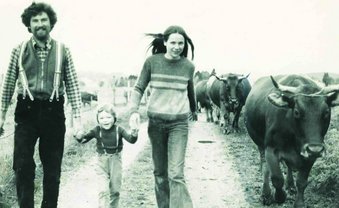





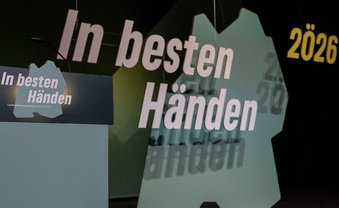


2 Kommentare verfügbar
-
Reply
ein hochinteressanter Artikel, vielen Dank!
Kommentare anzeigenGun Wille
at