Im Stift traf er 1821 in der "Geniepromotion" auf spätere Berühmtheiten wie David Friedrich Strauß, der zu einem der einflussreichsten Theologen des 19. Jahrhunderts werden sollte. Zimmermanns und Strauß' Lehrer Ferdinand Christian Baur versuchte, auf der Grundlage des Hegelschen Entwicklungsdenkens das Verständnis von Geschichte und Theologie aus der dogmatischen Erstarrung zu befreien. Strauß wandte diesen Ansatz später mit seiner Historisierung des "Leben Jesu" (1835) auf die Kirchengeschichte, Zimmermann auf die Sozialgeschichte an.
Im Stift entwickelte sich Zimmermann zum oft gelobten, manchmal überheblichen Klassenprimus. Ab dem vierten Semester allerdings häuften sich die Strafen, etwa weil er zu viel im Wirtshaus saß. 1829 wurde er vom Stift verwiesen und musste seine Prüfung vorzeitig und mit eher durchschnittlichem Ergebnis ablegen. Die Versetzung als Vikar ins abgelegene Schweindorf bei Aalen war von Seiten der Kirche nicht ohne Hintergedanken. 1831 legte er in Stuttgart sein zweites Pfarrexamen ab. Doch es zog ihn zunächst nicht auf eine Pfarrstelle.
Dichter romantischer und politischer Lyrik
1832 promovierte er in Tübingen über römische Literatur – bei Ludwig Uhland. Schon während des Studiums war er mit dem Dichter Wilhelm Waiblinger durch die Kneipen gezogen, nun versuchte er sich selbst als Dichter. Zusammen mit Eduard Mörike, der ihn schätzte, gab er 1835 das "Jahrbuch schwäbischer Dichter und Novellisten" heraus. Neben Romantischem schreibt er bald politische Lyrik wie die Solidaritätslieder mit den Besiegten des polnischen Aufstands von 1830/31:
Wider den Despotismus: Denn Freiheit muss werden auf Erden,
Freiheit im Reiche des Geists, Freiheit im Reiche der Welt.
Nach der Julirevolution von 1830 in Frankreich verschärfte der württembergische König Wilhelm I. Zensur und politische Unterdrückung. Vor seine erste Gedichtsammlung setzte Zimmermann 1832 daher das Motto:
Muss aus des Tags Geschichte
Entflieh'n das freie Wort,
dann bleibt ihm im Gedichte
Ein heil'ger Zufluchtsort.
Zimmermanns Prosaarbeiten entzogen sich der Zensur, indem sie Kritik ins historische Gewand verkleideten, wie 1833 im Trauerspiel "Masaniello, der Mann des Volkes", das vom Aufstand der Neapolitaner gegen die spanische Herrschaft handelt:
Ein neuer Geist geht durch die Welt. Das Volk
Fängt, dass es Mensch sei, einzusehen an.
Über solche historischen Stoffe fand er zur Geschichtsschreibung.
Der Historiker des Bauernkriegs
Von den unsicheren und mageren Honoraren konnte Zimmermann seine wachsende Familie nicht ernähren. 1840 bewarb er sich um eine Stelle im kirchlichen Dienst und wirkte bis 1847 als Pfarrhelfer in Dettingen an der Erms. Hier im Pfarrhaus, schrieb seine Frau Luise, die er 1832 geheiratet hatte, "entstand seine Allgemeine Geschichte des großen Bauernkrieges, ganz aus Archivquellen gearbeitet. Die Direktion des Kgl. Staatsarchivs stellte ihm mit der edelsten Liberalität die Aktenstücke zur jahrelangen Benützung in seinem Hause frei".
Zwischen 1841 und 1843 erschien das dreibändige Werk. Es war die erste wissenschaftliche Darstellung des Bauernkriegs und zudem eine, die von einer großen Sympathie für die aufständischen Bauern geprägt war. Zimmermann setzte den Bauernkrieg von 1524/25 in einen größeren Kontext, betrachtete ihn als Kulminationspunkt eines Jahrhunderte andauernden Kampfes zwischen Unterdrückten und Unterdrückern. Und er sah in ihm das Idealbeispiel einer Revolution.
Die größte Wirkung hatte das Werk erst mit einigen Jahrzehnten Abstand. Der Stuttgarter Sozialist Fritz Rück berichtete in seinen Erinnerungen an seine Jugendzeit um die 1900 von der Faszination, die ein Buch über den Bauernkrieg, das einzige im Gaisburger Arbeiterhaushalt, auf ihn ausgeübt hatte – Zimmermanns "Bauernkrieg", den der sozialdemokratische Dietz-Verlag 1891 mit vielen Illustrationen als erheblich gekürzte, "billige Volksausgabe" herausbrachte. Erst in dieser Form wurde "der Zimmermann" zu einem bis heute in Dutzenden Ausgaben nachgedruckten Bestseller.
Bei seinem ersten Erscheinen in den 1840er-Jahren wurde das Buch, so Otto Borst, interpretiert "als ein Beitrag zum latenten und geistigen Freiheitskampf der vormärzlichen Gegenwart". In Baden, Bayern und Österreich wurde es verboten, von Friedrich Engels 1850 hoch gelobt und genutzt. 1891 las man es angesichts des gerade ausgelaufenen Sozialistengesetzes als Beitrag zum Freiheitskampf der Arbeiterbewegung. Käthe Kollwitz inspirierte das Buch 1908 zu ihrem berühmten Bauernkriegszyklus, Gerhart Hauptmann zu seinem Drama "Florian Geyer". Seinen Erfolg verdankt "der Zimmermann" aber bis heute seiner bilderreichen und lebendigen, ja mitreißenden Sprache.
Bei der äußersten Linken im Paulskirchenparlament
Neben seiner Arbeit als Schriftsteller und Historiker betätigte sich Zimmermann auch politisch. Er arbeitete an Zeitschriften der demokratischen Opposition im Land mit, engagierte sich im "Volksverein" und wurde 1848 als Abgeordneter des Wahlkreises Schwäbisch Hall in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, die in der Paulskirche tagte. Hier stand er auf der Seite der "äußersten Linken", wie er selbst sagte, und setzte sich für energische Schritte ein, vor allem für die Schaffung eigener Machtorgane. Deren Fehlen habe, wie er in der Rückschau urteilte, die Niederlage von 1849 besiegelt.
Für Württemberg wollte König Wilhelm I. nach der Revolution von 1848/49 eine Verfassung in seinem Sinn. Er ließ dazu mehrmals einen Landtag wählen und auflösen, bis ihm das Ergebnis passte. Bis 1854 gehörte Zimmermann diesen Landtagen an. Unerschrocken setzte er sich für die Aufnahme der Grundrechte in die Verfassung ein, für ein allgemeines Wahlrecht und gegen die "Heeresvermehrung": "Wir wollen kein Geld verwilligen, um dem Frieden des Kirchhofs den deutschen Ländern zu oktroyieren", für Waffen, die helfen, "das monarchische Prinzip im Gewande des Despotismus" wieder einzuführen.













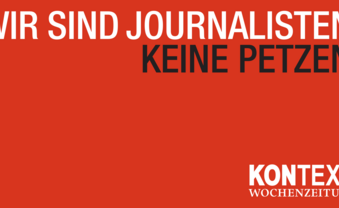


1 Kommentar verfügbar
-
Reply
Es freut mich sehr, dass Ihr einen - leider arg vergessenen - Schriftsteller würdigt, der sich so intensiv mit den Bauernkriegen befasst und auf die Seite der Bauern gestellt hat. Im Gegensatz dazu hat die Rutenfestkommission in Ravensburg beschlossen, das Abbild eines Landsknechts als Festabzeichen…
Kommentare anzeigenSabine Hofmann-Stadtländer
at