Der Auftakt der Aktion im Rahmen der diesjährigen CSD-Kulturwochen in Stuttgart scheint laut den Initiator:innen vielversprechend gewesen zu sein. "Nahezu alle an der CSD-Hocketse beteiligten Organisationen haben die Aktion unterstützt", freute sich Lars Lindauer von der IG CSD, in kurzer Zeit seien 500 Unterschriften zusammengekommen. Mittlerweile sind es knapp über 1.000 (Stand 14. Oktober), und die Palette der unterzeichnenden Personen und Gruppen ist breit: Die ehemalige grüne Landtags-Vizepräsidentin Brigitte Lösch gehört ebenso dazu wie der Polizeioberrat Jens Rügner, Leiter des Stuttgarter Innenstadtreviers, oder die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg (IRGW).
Die Stimmung trübte allerdings schon nach kurzer Zeit ein Passus aus einem Artikel in den beiden Stuttgarter Tageszeitungen StZ und StN. Dort wurde die Aktion ausdrücklich begrüßt, aber darauf hingewiesen, dass das Ansinnen "rechtlich nicht möglich" sei, denn: "Das geltende Stuttgarter Stadtrecht schließt selbst eine symbolhafte Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Verstorbene aus."
Marlene Dietrich wurde posthum zur Ehrenbürgerin
Ralf Bogen vom Projekt "Der Liebe wegen" macht das stutzig. "Es gibt bereits einige Fälle einer posthumen Verleihung der Ehrenbürgerwürde", sagt Bogen. So verlieh etwa die Stadt Berlin 2002 der einige Jahre zuvor gestorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich, auch wegen ihres Engagement gegen die Nazis, die Ehrenbürgerwürde. Und im Mai 2025 verlieh die Stadt Euskirchen die Ehrenbürgerwürde an Willi Graf, der 1943 wegen Verteilens von Flugblättern der Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" hingerichtet worden war.
Bogen fragte daher im Juli in der Abteilung Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Stadt Stuttgart nach, welche Rechtsvorschrift genau denn die posthume Verleihung der Ehrenbürgerwürde verbiete. Etwa eine Regelung im Stadtrecht, die es so in Berlin oder Euskirchen nicht gibt? Eine solche konnte ihm bislang jedoch nicht genannt werden.
Die baden-württembergische Gemeindeordnung selbst ist wenig konkret. In deren Paragraf 22 steht nur: "Die Gemeinde kann Personen, die sich besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen." Und: "Das Ehrenbürgerrecht kann wegen unwürdigen Verhaltens entzogen werden." Mehr nicht. Eine Lebendbedingung ist nirgendwo im Wortlaut fixiert, eine posthume Verleihung demnach nicht ausdrücklich verboten.
Stadt stützt sich auf Rechtskommentare
Also fragt nun Kontext bei der Stadt Stuttgart, ob und was für sie aus rechtlicher Sicht gegen eine posthume Verleihung spricht. Als Antwort der Pressestelle erfolgt der Verweis auf besagten Paragraf 22 und dass die Voraussetzung für eine Verleihung "nach allgemeiner Meinung" sei, dass die zu ehrende Person noch lebe – vor dem Hintergrund, "dass es sich um eine reine Ehrenbezeichnung und ein Persönlichkeitsrecht handelt". Deswegen komme, so die Stadt, "eine posthume Verleihung der Ehrenbürgerwürde (…) nach geltender Gesetzeslage in Baden-Württemberg nicht in Betracht."
Ist das wirklich so? Die Formulierung "nach allgemeiner Meinung" bezieht sich auf mehrere Titel von Rechtskommentaren, die von der Stadt angeführt werden. Nun handelt es sich bei Rechtskommentaren stets um Interpretationen von schriftlich fixiertem Recht, die so oder so ausfallen können. Nachfrage also: Ist die Lebendbedingung beziehungsweise die nicht in Betracht kommende posthume Verleihung tatsächlich in keiner Rechtsvorschrift explizit festgelegt, und stützt sich die Stadt allein auf die genannten Rechtskommentare?





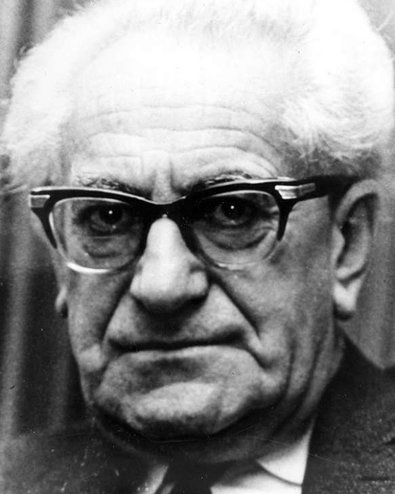













16 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Das war bei Robert Scholl (Vater der Geschwister Scholl und von 1945 bis 1948 erster Nachkriegsoberbürgermeister von Ulm) vor einigen Jahren auch so.
Kommentare anzeigenHeini Woldschläger
amDer Antrag auf die Ehrenbürgerschaft von Robert Scholl in Ulm durch die SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat, wurde von der Stadtverwaltung mit dem…