Die graue Granitskulptur erinnert an eine Lanzenspitze, auf ihrer Vordersetze steht: "Darumb erfindt sich mit der geschryfft das wir frey seyen und woellen sein". Grob in heutiges Deutsch übertragen: In der Bibel steht, dass wir frei sind und sein wollen. Es ist ein Zitat aus den 1525 verfassten "Zwölf Artikeln", einem zentralen Schriftstück für das Aufbegehren von Bauern und Stadtbewohnern vor 500 Jahren. Dass das Zitat das Sebastian-Lotzer-Denkmal in Horb schmückt, hat einen Grund: Die Artikel werden dem 1490 in der Neckarstadt geborenen Lotzer zugeschrieben.
Das Denkmal, angefertigt von Markus Wolf, wurde bereits 2006 auf Initiative des Kultur- und Museumsvereins an der Kehre der Horber Wintergasse zum Marktplatz errichtet. In der letzten Zeit dürfte das Interesse an ihm aber gewachsen sein. Denn Horb erinnert zum 500. Jahrestag der Bauernrevolution, die als Bauernkrieg in die Geschichtsbücher eingegangen ist, recht umfangreich an Lotzer. "Die Geburtsstadt des Mitverfassers der Zwölf Artikel würdigt sein Erbe mit einem Jahr voller Veranstaltungen", heißt es im Horber Amtsblatt. Dort wird auch betont, dass die Stadt "trotz finanzieller Herausforderungen und ohne Fördermittel durch Bund und Land" das ambitionierte Programm realisiert hat, das sich um die Begriffe "Freiheit" und "Gerechtigkeit" dreht. An diesen Begriffen zeigen sich auch einige Probleme eines solchen Gedenkens.
Explizit erwähnt wird der Begriff "Freiheit" nur in Artikel 3 der Zwölf Artikel. Hier wird die Freiheit aller Menschen religiös begründet. Darauf weist auch Joachim Lipp in dem von der Stadt Horb produzierten Podcast "Für Freiheit & Gerechtigkeit – Sebastian Lotzers Erbe" hin. "Den Bauern ging es zunächst mal nicht um Menschenrechte, sondern um handfeste wirtschaftliche Probleme, die sich aus übermäßigen Belastungen ergaben", sagt der pensionierte Lehrer Lipp. Und er betont, dass mit den Begriff Freiheit in den Zwölf Artikeln die Befreiung von Diensten und Leistungen, die aus der Leibeigenschaft resultieren, und die Wiederherstellung "der alten Ordnung" gemeint ist.
Wiederentdeckung erst zum Jubiläumsjahr
Lipp war 30 Jahre lang Vorsitzender des Kultur- und Museumsvereins von Horb und hat sich intensiv mit der städtischen Geschichte befasst. Ihm ist bei seinen historischen Forschungen aufgefallen, dass Lotzer in der Geschichtsschreibung der Stadt lange Zeit "null Bedeutung hatte". Lotzer findet man weder im "Horber Bilderbuch" auf der Fassade des Horber Rathauses, noch ist er im Heimatbuch unter den wichtigen Persönlichkeiten Horbs aufgeführt. "Lotzer war der verlorene Sohn der Stadt, und um den haben wir uns ein bisschen gekümmert", beschreibt Lipp die Wiederentdeckung zum Jubiläumsjahr.
Mit diesem lange unbeachteten historischen Fundus steht die Neckarstadt nicht alleine da. Auch Stolberg im thüringischen Harz wollte von dem "christlichen Revolutionär" Thomas Müntzer, der dort geboren wurde, nach dem Ende der DDR nichts mehr wissen. Doch zum 500. Jahrestag der Bauernrevolution und der Hinrichtung Müntzers wirbt das Harzstädtchen mit dem Motto "Gerechtigkeyt – Thomas Müntzer & der Bauernkrieg". Sogar eine Biersorte trägt für ein Jahr Müntzers Konterfei. Wie in Horb wird auch in Stolberg mit den Begriffen Freiheit und Gerechtigkeit eine große Linie von den Bauernkriegen bis in unsere Gegenwart gezogen. Dabei wird allerdings vergessen, dass diese Begriffe vor 500 Jahren eine andere Bedeutung hatten.
Problematische Schlüsse von Vergangenem aufs Heute
Historiker:innen sprechen sich mit guten Argumenten dagegen aus, Begrifflichkeiten aus einem Schlüsseldokument des 16. Jahrhunderts mit heutigen Diskursen gleichzusetzen und daraus Schlussfolgerungen für die Gegenwart zu ziehen. Besonders absurd ist es, wenn dann die aufständischen Bauern zu einer Art Vorläufer des Grundgesetzes verklärt werden. Da wird Geschichte für aktualisierte Zwecke instrumentalisiert. Der Historiker Lipp kritisiert nicht zu Unrecht, dass DDR-Historiker:innen aus Thomas Müntzer einen Vorläufer des Sozialismus machen wollten. Genauso sollte dann aber auch kritisiert werden, wenn bei den bundesweiten Events zum 500. Jahrestag aus den aufständischen Bauern Vorläufer:innen der heutigen Zivilgesellschaft gemacht werden. Dabei geht unter, dass es vor 500 Jahren um einen Aufstand gegen Frondienste, Ausbeutung und Willkür der vielen kleinen und großen Feudalherren gegangen ist.
Eines der Projekte, mit denen vor allem jüngere Menschen angesprochen werden sollen, ist der Videopodcast "Für Freiheit & Gerechtigkeit. Sebastian Lotzers Erbe". In dem auf zwölf Folgen angelegten Podcast sprechen Horber Bürger:innen aus heutiger Sicht über unterschiedliche Aspekte von Freiheit und Gerechtigkeit. Die Bandbreite reicht von Steuergerechtigkeit bis zu "gesunder und gerechter Ernährung". Was das mit den Aufständen vor 500 Jahren zu tun hat, erschließt sich nicht. Da ging es oft um den drohenden Hungertod und Mangelernährung. Mit solchen historischen Fakten will man die Zielgruppe der Podcasts erst gar nicht behelligen.
Sollten dann doch mal Verweise auf die Historie gezogen werden, grenzt es schon beinahe an Geschichtsklitterung, wenn es im Horber Amtsblatt heißt: "War es im Jahr 1525 der Buchdruck, der Lotzers 'Zwölf Artikel' weit verbreitete, so sind es heute Wort und Bild des Videopodcasts, die seine Ideen in die Gegenwart tragen". Dabei werden die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgeblendet, die vor 500 Jahren dazu führten, dass die 12 Artikel die "alte Ordnung" ins Wanken brachten, während die Podcasts bestenfalls dazu beitragen könnten, dass jüngere Menschen sich wieder mehr mit Geschichte und den potenziellen Lehren beschäftigen.
Theaterstück und "RevoLotzer"-Ausstellung
Um Lotzers Biografie wiederum dreht sich das Theaterstück "Sebastian Lotzer, ein bedeutender Sohn der Stadt Horb", das Ende Juli und Anfang August auf dem Marktplatz von Horb aufgeführt wurde. Der Stadthistoriker Joachim Lipp war auch hier involviert, diente als Berater des von Pina Bucci inszenierten Stücks. Dessen erster Teil befasst sich mit dem Konflikt des jungen Lotzer mit seinem Vater, der seinen Sohn zum Theologiestudium drängte, damit er in seine Fußstapfen tritt. Der Junior fügte sich nicht, lernte das Handwerk eines Kürschners und ging mit seinem Gesellenbrief auf Wanderschaft, wodurch er nach Memmingen kam.
Im zweiten Teil des Stücks wird Lotzer als Akteur in der freien Reichsstadt Memmingen dargestellt. Hier wird er zum historischen Zeugen, der mit den Zwölf Artikeln die Forderungen der Bauern für die Nachwelt erhält, beseelt von der biblischen Botschaft der Gewaltfreiheit. Seine Flucht in die nahegelegene Schweiz rettet ihm sein Leben.
Auch künstlerisch, aber mit den Mitteln von Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei und Installationskunst setzen sich wiederum 33 Kunstschaffende in der Ausstellung "RevoLotzer" mit Lotzer, dem Bauernkrieg und den Bezügen zu heute auseinander. Ihre Werke sind im gesamten Horber Rathaus verteilt und die Schau noch bis zum 19. September zu sehen.
Doch nicht nur Horb erinnert sich zum 500er-Jubiläum ihres verlorenen Sohnes. Im bayerischen Memmingen ist in der Krämerzunft am historischen Ort ein Teil der Ausstellung "Projekt Freiheit – Memmingen 1525" zu sehen. Im März 1525 hatten dort Abgesandte der oberschwäbischen Bauern über ihr weiteres Vorgehen beraten. Kurz nach dem Treffen wurden die Zwölf Artikel veröffentlicht. Höhepunkt der Ausstellung ist die Installation mit der sprechenden Decke in der Krämerzunft, dem einzigen nach 500 Jahren noch original erhaltenen Gebäudeteil. Eine Frauenstimme spricht über die Ambitionen des Laientheologen Sebastian Lotzer und seines Mentors Christoph Schappeler.
Diese unterschiedlichen Formate vermitteln wichtige historische Eindrücke. Doch es zeigen sich auch Leerstellen.
Der Bauernschlächter und seine Erben
Lotzers Bestreben, dass die Bauern ihre Forderungen mit friedlichen Mitteln durchsetzen, wird von der alten Ordnung mit Gewalt beantwortet. Es waren Figuren wie der Truchsess Georg von Waldburg, auch "Baurnjörg" genannt, die den Aufstand der Bauern brutal niederschlugen. "Obwohl er nicht als Richter eingesetzt worden war, ließ er entgegen dem geltenden Recht, selbst nach der völligen Unterwerfung der Aufständischen, Abertausende foltern und hinrichten", schrieb der Schriftsteller Bernd Engelmann über den Bauernjörg in dem Buch "Ihr da oben – wir da unten", das er 1975 gemeinsam mit Günther Wallraff herausgegeben hat. Dort wird auch beschrieben, wie die Erben des Bauernschächters noch immer zu den reichen Großgrundbesitzer:innen mit viel Macht und Einfluss gehören.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur heute wird darüber kaum noch gesprochen. Dafür werden 500 Jahre nach der Niederschlagung der Bauernrevolution die Begriffe Freiheit und Gerechtigkeit als überhistorische Schlagworte benutzt.
Wenn das Jubiläum vorbei ist, dürfte es in Horb wieder ruhig um Sebastian Lotzer werden. Dann bleibt womöglich nur der "klitzekleine Winkel", wie der Historiker Joachim Lipp in der Neckarchronik den Ort in Horb nennt, der seit 1991 Lotzers Namen trägt.





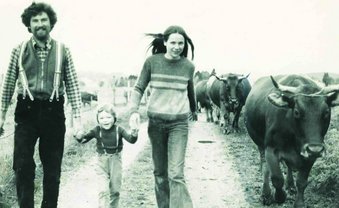









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!