Ist die Wohnungsnot Geschichte? Zumindest ist in der "Wirtschaftswoche" von immer mehr Menschen zu lesen, die sich weltweit den "Traum vom Eigenheim" erfüllen. Juhu, jetzt wohnen bestimmt alle schöner! Mit hohen Decken, Parkettboden, Minimum, außerdem Möbel aus Massivholz, ein traumhafter Ausblick und dann noch ein kleiner See vor der Haus, hoffentlich. Aber wie kommt's? Sind Grundstücke wieder bezahlbar? Oder die Baupreise gesunken? Hat der Staat etwa Regelungen gegen die Spekulation mit Lebensraum durchgesetzt?
Natürlich nicht. Die Rede ist nur vom Tiny House, der Heim gewordenen Sardinenbüchse, die sich vor allem, aber nicht nur in den USA "immer größerer Beliebtheit erfreut" – insbesondere seitdem fast zehn Millionen Menschen durch die Finanzkrise von 2008 zur Zwangsversteigerung ihrer Immobilien genötigt wurden. Doch eine erfolgreiche Wirtschaft verdient an den Problemen, die sie hervorbringt. Sodass die Minihäuser, wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, "manch einen vor der Obdachlosigkeit gerettet" haben. Und bevor massenweise Menschen auf der Straße landen, ist es in einer reichen Gesellschaft vorzuziehen, wenn neue Marktsegmente erschlossen werden.
Wie gewiefte DesignerInnen sich von verwahrlosten Wohnwagensiedlungen inspirieren lassen, um das Mode-Angebot mit "White Trash Fashion" zu bereichern, deren Kostenpunkt meist das Monatsgehalt der im Elend Versinkenden übertrifft, an deren Stil sie sich bedienen, so gelingt es auch der Tiny-House-Industrie eine der Armut entsprungene Idee erfolgreich zu kapitalisieren. Beim Schmackhaftmachen wird sie dabei unterstützt von einem als Presse getarnten Hilfsnetzwerk, das, vermutlich ohne sich seiner Rolle bewusst zu sein, den Verkauf der Wohnungen für Winzlinge mit wohlwollenden Berichten ankurbelt und es zur Tugend verklärt, sich in beengende Verhältnisse einzurenken.
"Die Idee dahinter" verrät zum Beispiel das Online-Portal "Golem" ohne erkennbares Problembewusstsein: "Wenn Immobilienpreise zu hoch und Baugrundstücke Mangelware sind, müssen halt deutlich weniger Quadratmeter ausreichen – für Singles und Paare ohne Hang zu großem Konsumballast vielleicht eine echte Alternative." Die im Raubtierkapitalismus allgegenwärtige Apologie der herrschenden Verhältnisse macht aus Menschengemachtem ein Naturgesetz: Wenn es so ist, dann muss es eben so sein. Die Wohnkosten steigen nunmal, also gibt es daran nichts zu rütteln – deal with it.
Obdachlose können sich kein Tiny House leisten
Und leider funktioniert das Marketing erschreckend gut: Die Quadratmeterpreise werden ja tatsächlich für immer mehr Menschen unbezahlbar. Also ertappt man auch sich selbst nicht selten bei dem Gedanken, wie lohnenswert es wäre, der Auspressung als Mietobjekt durch eine einmalige Investition auf immer und ewig zu entfleuchen – sogar wenn es bedeuten würde, sich ein Leben lang auf Besenkammergröße einzupferchen.




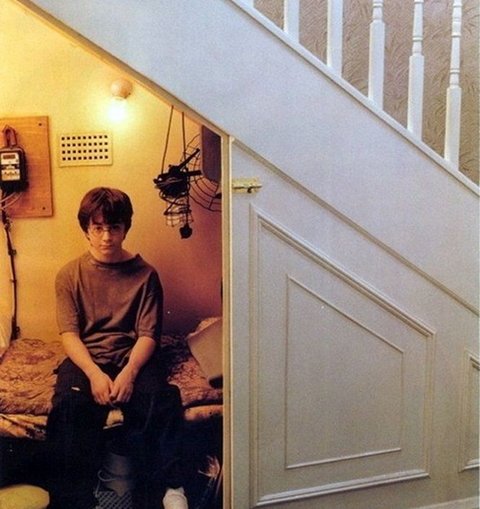










2 Kommentare verfügbar
-
Reply
Ein sehr schöne, teilweise bissiger Kommentar oder sollte ich "Artikel" schreiben? Egal - er bringt die Menschen zum Nachdeneken, ob ein Tiny House, ein Mobilhaus oder eine andere Form von Mirkohäusern zu ihrem Leben passen. Daher wollen wir über eine virtuelle Messe über diesen Trend informieren…
Kommentare anzeigenLars Bosse
at