Um politische Profilierung geht es offensichtlich auch, wie der Bezahlkartentermin mit Staatssekretär Lorek zeigt. Andere beim Pressegespräch Anwesende verweisen eher auf Digitalisierung und Entlastung. So betont Jochen Zühlcke vom Regierungspräsidium Karlsruhe, dass die Karte den Verwaltungsaufwand verringere. Statt Bargeld die Karte auszugeben, entlaste Mitarbeiter:innen. Geplant sei, dass nun zunächst in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen, anschließend in den Stadt- und Landkreisen die Bezahlkarte angewandt wird. Auch Joerg Schwitalla von der Publk GmbH, die den Auftrag für die Bezahlkarte bekommen hat, unterstreicht, es ginge um Digitalisierung und Vereinfachung, und führt als Beispiel Hannover an, wo seine Firma bereits im Dezember 2023 aktiv war. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) wollte mit der SocialCard vor allem Teilhabe fördern und Verwaltung verschlanken. Die SocialCard gab es nicht nur für Asylbewerber:innen sondern für alle Sozialhilfeempfänger:innen ohne Konto, und man konnte mit ihr alles machen – ohne Abhebegrenzen oder irgendwelche Einschränkungen bezüglich Online-Handel oder ähnliches. Sechs Beschäftigte in der Verwaltung seien so von der aufwendigen Bargeldauszahlung befreit worden und konnten sich sinnvolleren Aufgaben widmen, schreibt die Stadt auf ihrer Website.
Doch damit ist bald Schluss. Denn nun führt auch Niedersachsen die Bezahlkarte für Geflüchtete ein, und deshalb muss Hannover sein System wahrscheinlich umbauen.
Gerichte sind beschäftigt
In der Erstaufnahme bei Karlsruhe beeilt sich dann auch Staatssekretär Lorek zu erklären, die Karte zeige, dass "moderne Technik und effiziente Verwaltung funktionieren". Ob dem so wird, muss sich noch erweisen. So darf die politisch festgelegte Obergrenze von 50 Euro für Bargeldabhebungen nicht pauschal festgelegt werden. Das haben bereits Sozialgerichte in Nürnberg und Hamburg festgestellt. Vielmehr, so die Urteile, müssten individuelle Umstände, zum Beispiel Schwangerschaft, berücksichtigt werden.
Warum gibt es die 50-Euro-Grenze in Baden-Württemberg nun trotzdem? Lorek glaubt, man sei auf der sicheren Seite, denn es könnte auf Antrag auch mehr Bargeld gestellt werden. Wo müssten Geflüchtete das beantragen? "Bei der Ausländerbehörde." Gibt es dafür ein Antragsformular? Lorek wird ärgerlich. "Da genügt zur Not wohl eine E-Mail." Die Entscheidung, ob ein Geflüchteter mehr Geld abheben darf, soll also in der persönlichen Einschätzung eines Behördenmitarbeiters liegen. Ob das vor Gericht hält, wird sich sicherlich noch herausstellen.
Bundesweit gibt es übrigens trotz der Einigung von 14 Ländern weiterhin Unterschiede. Thüringen und Bremen wollen 120 Euro Barabhebung zulassen, manche Bundesländer erlauben pro minderjährigem Kind zehn Euro in bar, andere 50 Euro. In Nordrhein-Westfalen wird die Karte zunächst nur in den Landesunterkünften eingeführt, ob die Kommunen Karte oder Bargeld ausgeben, dürfen sie selbst bestimmen.
Es könnte so einfach sein, wie das Beispiel Hannover zeigt: Entlastung für die Behörden durch Digitalisierung und eine ganz normale Bezahlkarte mit allen Rechten für die Geflüchteten. Doch darum geht es eben nicht. Es geht um Kontrolle, um die Unterstellung, dass Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten, per se zu misstrauen ist. Und um Wahlkampf.

















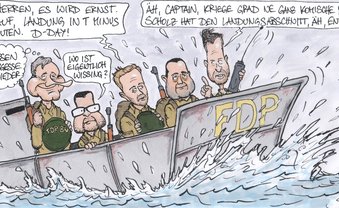


1 Kommentar verfügbar
-
Antworten
Das liegt wohl daran, dass Menschen in diesem Land grundsätzlich misstraut wird.
Kommentare anzeigenCathrin Ramelow
amIch habe das zuletzt als Angestellte erlebt wo allen unterstellt wurde, dass sie eigentlich den Arbeitgeber nur beschei... wollen.
Ich könnte mit so einer Einstellung nicht leben, aber viele tun dies anscheinend sehr…