Neben autoritären Bedrohungen von außen und innen steht die wehrhafte Demokratie vor einer weiteren großen Herausforderung: Der politische Journalismus verliert schleichend an Substanz. Und damit ist hier nicht gemeint, dass die Branche früher mit mehr Herzblut gearbeitet hätte. Vielmehr gruppiert sich ein Komplex von Schwierigkeiten um ein Nachrichtengeschäft unter wirtschaftlichen Zwängen – mit steigendem Druck, zwischen Aufwand und Ertrag abzuwägen.
Für eine funktionierende Demokratie hat guter Journalismus zwar einen höheren Stellenwert als Tütensuppen und Heizdecken. Doch die Romantik endet an der Verkaufstheke, wo eine Zeitung auch nur ein Produkt unter vielen ist und für das unternehmerische Kalkül entscheidend bleibt, dass die Herstellungskosten nicht dauerhaft über dem Verkaufspreis liegen. Aufwendige Recherchen kann sich ein Verlag vielleicht auch mal dann gönnen, wenn es sich um ein Verlustgeschäft handelt. Aber dann muss dieses Loch in der Kasse an anderer Stelle gefüllt werden, und so manch eine investigative Enthüllung ist auf Quersubventionierung angewiesen.
Das alles ist weniger heikel, solange das Kerngeschäft üppige Erträge bringt. Wenn zum Beispiel schon der ganz alltägliche Nachrichtenverkauf für schwarze Zahlen sorgt. Im Deutschland der Nachkriegszeit war die Gründung einer Zeitung gleichbedeutend mit einer Lizenz zum Gelddrucken. Doch die goldenen Zeiten sind längst vorbei, seit Jahrzehnten kämpfen die privatwirtschaftlich organisierten Presseunternehmen mit Auflagenschwund, der Papierpreisentwicklung und dem Verlust von Anzeigenkunden. Und auch die Deutungshoheit über das politische Geschehen verlagert sich von professionell kuratierten Medienerzeugnissen hin zur Anarchie sozialer Netzwerke.
Für Politiker:innen ist es eine attraktive Option, Botschaften ohne redaktionellen Filter unters Volk zu bringen und sich eine eigene Reichweite aufzubauen. Die direkte Kommunikation mit den Wahlberechtigten umschifft die externe Prüfung von Aussagen und Versprechen auf Plausibilität. Und beim Konkurrieren um Aufmerksamkeit entsteht ein Anreiz zu polarisieren, was wiederum mit Reichweite belohnt wird, weil Algorithmen sozialer Plattformen vor allem Polarisierendes belohnen. "Die Regeln der medialen Politikdarstellung – unterhaltsam, dramatisierend, personalisiert und mit Drang zum Bild, allesamt der Darstellungskunst des Theaters entlehnt – greifen auf das politische Geschehen selbst über", schrieb der Politikwissenschaftler Thomas Meyer bereits 2004. Seitdem hat sich dieser Trend zugespitzt: Viele Wortmeldungen im öffentlichen Diskurs haben eher den Charakter eines Schaukampfes als einer ernsthaft um inhaltliche Auseinandersetzung bemühten Debatte. Ein kerniges Zitat hat höhere Verbreitungschancen als trocken vorgetragene Expertise.
Eine Reihe von wissenschaftlichen Studien stellt über die Jahre eine abnehmende Aufmerksamkeitsspanne fest, Botschaften müssen kurz sein. Und das hat eine folgenreiche Kehrseite: Je differenzierter eine Position, desto schwieriger ist sie im Kurzformat vermittelbar – sofern der Versuch einer Vermittlung überhaupt noch unternommen wird. Doch die Pressebänke in politischen Gremien sind immer lichter besetzt: Aus Fachausschüssen zu berichten, wo Entscheidungen mühsam austariert werden, lohnt sich oft nicht, jedenfalls im ökonomischen Sinn.
Politik erbittet bessere Kontrolle
"Kommunalpolitik braucht einen starken Lokaljournalismus", schrieben 2022 fünf Landräte aus Baden-Württemberg in einem Brandbrief, da sie es als schädlich für die Demokratie einstufen, wenn die Presse bei kommunalen Sitzungen immer häufiger abwesend bleibt. Was wird aus der Kontrolle des parlamentarischen Geschehens durch die Öffentlichkeit? "Unser Anliegen an die Lokalpresse ist, Verwaltungen kritisch zu hinterfragen", heißt es in dem Schreiben, das mehr Kontrolle der eigenen Arbeit einfordert. Diese brauche "ausreichend Lokalredakteure, denn sie verfügen über das Handwerkszeug als Chronisten, Kritiker und Reporter. Ein größerer Stellenabbau bedeutet zwangsläufig Qualitätseinbußen der Berichterstattung."














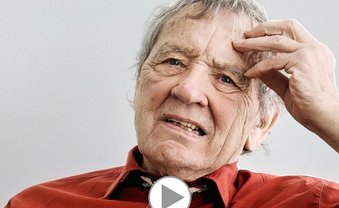


0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!