Die Habsburgerin, die Anfang Mai ihren 300. Geburtstag feiert, war einzigartig. Jedenfalls in den Augen von Élisabeth Badinter. Die französische Feministin hat sich sieben Jahre lang mit der Herrscherin, der Reformerin, der Mutter und vor allem mit der Frau Maria Theresia beschäftigt. Den Anstoß gab ein Zufall – als sie auf einen Briefwechsel zwischen der vierten von elf Töchtern, Maria Christina, und einer der Schwiegertöchter, Isabella von Bourbon-Parma, stieß. "Ich war fasziniert", bekennt die Philosophin.
An Kaiserinnen war über Jahrhunderte kein Mangel, an Herrscherinnen schon. Im alten Rom waren die ranghöchsten Frauen in der Regel Gattinnen oder Mütter. Die einzige chinesische Kaiserin überhaupt lebte im siebten Jahrhundert. Theophanu herrschte über das oströmische Reich am Ende des ersten Jahrtausends. In Schottland war Maria Stuart schon als sechs Tage altes Baby Königin. Frauen in ganz Europa führten die Geschäfte für ihre noch unmündigen Söhne, häufig besser als die erwachsenen Männer danach. Schweden hatte mit Christina I. im 17. Jahrhundert tatsächlich eine unverheiratete Königin. Nach zehn Jahren musste sie abdanken.
Als Maria Theresia 1740 mit gerade 23 Jahren ihrem Vater auf den Thron folgte, wurde ihr eine noch viel kürzere Regentschaft prophezeit. Denn Karl VI. hatte 1713, also vier Jahre vor der Geburt seiner ältesten Tochter, die "Pragmatische Sanktion" erlassen, ein Vertragswerk, das auch die Erbfolge neu regelte: Fehlte ein männlicher Stammhalter, war nun auch die weibliche Nachkommenschaft thronfolgeberechtigt – was sich als besonders weitsichtig erweisen sollte, denn Karls einziger Sohn starb 1716 kurz nach der Geburt, und danach gebar seine Gemahlin Elisabeth Christina nur noch Töchter.
Gleich zu Beginn ihrer Regentschaft marschieren die Preußen ein
Allerdings anerkannten nicht alle europäischen Herrscherhäuser, dass der Thron an eine Erbin statt an einen Erben übergehen sollte. Allen voran Friedrich II.: Keine sechs Wochen nach Karls Tod bot er einen Kuhhandel an und wollte für seine Zustimmung zur "Pragmatischen Sanktion" Schlesien abgetreten bekommen. Die Antwort der "Winterkönigin", wie Maria Theresia in Diplomatenkreisen ob des ihr vorhergesagten Verfallsdatums hieß, wartete er nicht ab, sondern marschierte ohne Kriegserklärung ein, besetzte diesen nordöstlichen Teil des ihres Reiches und stürzte die junge Regentin in einen über sieben Jahre dauernden Krieg. An dessen Ende 1748 standen Glanz, Gloria und Gebietsgewinne für den Preußenkönig. Zugleich aber musste er endgültig die neue Erbfolge schlucken.
"Als mein Herrn Vattern niemals gefällig ware, mich zur Erledigung weder aus auswärtigen noch inneren Geschäften beizuziehen noch zu informieren: so sahe mich auf einmal zusammen von Geld, Truppen und Rat entblößet", wird Maria Theresia später über Versäumtes klagen. "Die Herausforderungen, die auf diese Frau einstürmten, waren immens", analysiert Badinter. Während dieses ersten Kriegs sei Maria Theresia mehrfach mit fast aussichtslos erscheinenden Situationen konfrontiert gewesen. Offenbart habe sie dabei "einen Widerstandsgeist und einen außergewöhnlichen Mut, der die Bewunderung selbst ihrer ärgsten Feinde wecken sollte". Und sie habe bewiesen, "dass ihre Weiblichkeit der Machtausübung nicht nur nicht entgegenstand, sondern eine Trumpfkarte war, die sie grandios auszuspielen wusste".





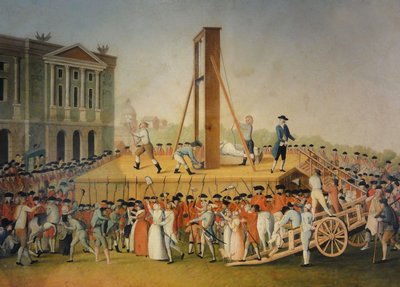










2 Kommentare verfügbar
-
Reply
Menschen die nur auf Kosten anderer gelebt haben haben keine Auszeichnung verdient. Die selbsternannten Adels- und Königshäuser müssen ihren geraubten Besitz zurückgeben und bei ihren Opfern um Gnade bitten
Kommentare anzeigenEuroTanic
at