Allein die FDP ist auf der vergleichsweise sicheren Seite: Sie hat zwar mitregiert in Baden-Württemberg zwischen 1996 und 2011, aber nie das Kultusministerium geführt. Und so ist es kein Wunder, dass Landes- und Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss droht, um aufzudecken, wie es dazu kommen konnte, dass mutmaßlich über Jahre immer mehr Lehrkräftestellen unbesetzt blieben, obwohl sie finanziert waren.
Die gegenwärtige Debatte dreht sich um 1,5 Prozent des Personalbestands an Lehrkräften, 1.440 Stellen, so ist jedenfalls der aktuelle Stand. Mitte Juli wurde bekannt, dass die Stellen zwar finanziert, wegen einer IT-Panne aber als besetzt verbucht wurden, obwohl sie gar nicht besetzt waren. Bei 4.500 Schulen im ganzen Land hätte rein rechnerisch also jede dritte Schule im Südwesten genau eine Lehrkraft mehr gehabt.
Insgesamt aber geht es um deutlich Grundsätzlicheres, weil der über viele Jahre unentdeckt gebliebene Software-Fehler – Stand heute vermutlich seit 2005 – noch ganz andere Mängel offenbart: Es hakt bei der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Verwaltungsebenen, im Landesamt für Besoldung, nicht zuletzt im Haushaltscontrolling. In den ersten Tagen, nachdem die Panne bekannt geworden war, war nicht einmal klar, wo eigentlich das Geld ist, mit dem die Lehrkräfte hätten bezahlt werden müssen, aber nicht bezahlt worden sind, weil sie gar nicht eingesetzt waren. Inzwischen ist immerhin klar, was mit den zusätzlichen Lehrkräften, wenn sie denn mal besetzt sind, passieren soll: Der größte Teil soll an die dramatisch unterbesetzten früheren Förderschulen gehen, die heute Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) heißen.
Immer wieder Digitalisierungsversprechen
Seit Jahren wälzen alle Parteien viele gute Vorsätze und Ideen, Baden-Württemberg mehr oder weniger rundum zu digitalisieren, zum Nutzen von Bürgerschaft und Unternehmen. Im Koalitionsvertrag der ersten der letzten drei grüngeführten Landesregierungen, 2011 mit der SPD geschlossen, spielt das Thema noch keine große Rolle. Der zweite Vertrag 2016 mit der CDU strotzt dagegen vor einschlägigen Versprechen: "Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir eine moderne Verwaltung 4.0 einrichten, in der Mitarbeiter und Bürger gleichermaßen von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren." Oder: "Für das Innovationsland Baden-Württemberg ist es von zentraler Bedeutung, die Chance der Digitalisierung zu nutzen. Alle Branchen sollen von der Digitalisierung profitieren." Oder: "Wir werden die Potenziale der Digitalisierung dazu nutzen, die ökologische Modernisierung der Wirtschaft voranzutreiben."
180-Mal kam der Begriff "digital" auf den 140 Seiten der grün-schwarzen Koalitionsvereinbarung von 2016 vor. Digitalisierung wurde ausdrücklich in den Namen des Innenministeriums aufgenommen, das seitdem "Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen" heißt. Die Zahl der unbesetzten Lehrkräftestellen dürfte zu diesen Zeitpunkt nach den aktuellen Schätzungen schon auf etwa 770 angewachsen gewesen sein. Der damals neue Innenminister Thomas Strobl (CDU) versprach, dass Baden-Württemberg zur "digitalen Leitregion in Europa" werde, weil "nirgendwo so viel Innovationskraft steckt". Nicht einmal in der Erarbeitungsphase der 2017 präsentierten ersten Digitalisierungsstrategie des Landes kamen die Verantwortlichen auf die Idee, alle bisherige Prozesse auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Und 2022, als die Fortschreibung vorgelegt wurde, erst recht nicht.
Hinweise des Rechnungshofs bewirkten nichts
Dem Landesrechnungshof schwante mehrfach, dass mit Blick auf die komplizierte Verwaltung der Lehrkräftestellen irgendwas nicht stimmen kann. Rund um die Bruchlandung, die 2018 die landesweite Bildungsplattform "ella" hinlegte (Kontext berichtete), wurde auf Antrag der FDP vom Landtag eine umfangreiche Mitteilung auch zur Software "Allgemeine Schulverwaltung" (ASVBW) in Auftrag gegeben. Die Karlsruher Behörde formulierte 2019 verschiedene Empfehlungen, die die Komplexität belegen. Konkret auf die Spur der fehlenden Stellen kam jedenfalls niemand. Wie schon ihre Amtvorgänger:innen, nahm auch die damalige Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Hinweise des Rechnungshofs nicht zum Anlass einer grundsätzlichen Analyse der damals schon fast 15 Jahre eingesetzten Software. Noch ein Hinweis dafür, wie Digitalisierung sicher nicht gelingt.









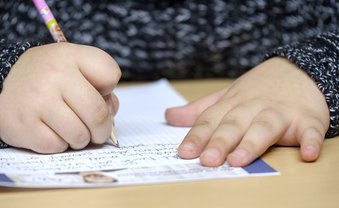






1 Kommentar verfügbar
-
Antworten
Es wäre gut, würde man aus dieser Panne eine Lektion für die Digitalisierungsanbeter ableiten: Nicht alles, was eine Software ausspuckt, ist richtig oder gut. Es ist der Mensch, der die Kontrolle behalten muss. Und wenn er die Struktur nicht mehr überblicken kann, dann muss diese geändert werden.…
Kommentare anzeigenAndrea K.
vor 1 Tag