Postkarten aus dem Urlaub zu schreiben ist out, obwohl eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Post kürzlich ergab, dass sich 65 Prozent der Befragten über Urlaubsgrüße per Postkarte freuen. Sie seien persönlicher als digitale Grüße. Erst auf Platz zwei folgten Grüße über Messengerdienste (61 Prozent), danach Anrufe, soziale Netzwerke und E-Mails. Aber Postkartenschreiben ist halt auch Arbeit. Und es wird selbst in Touristenhochburgen immer schwieriger, noch Kartenständer, Briefmarken und Postkästen zu finden. Erfolglos wird die Suche bald in Dänemark enden: Die Post dort stellt zum Jahresende die Briefzustellung in Dänemark ein. Die Zahl versendeter Briefe sei seit 2000 um 90 Prozent gesunken, heißt es.
Im Gegensatz zum persönlichen Brief, dem Internet und Mobilfunk schon seit Längerem den Garaus gemacht haben, hat sich die Postkarte aber bisher wacker gehalten. 2024 beförderte die Deutsche Post davon rund 96 Millionen – Tendenz allerdings sinkend. 2017 waren es noch 195 Millionen. Wann der Urlaubsgruß per Post gänzlich verschwindet, ist in unserer digitalen Welt nur eine Frage der Zeit.
Dabei sind Postkarten mehr als nur freundliche Grüße aus der Ferne. Sie können zu historischen Dokumenten mutieren. Sie verschwinden nicht, wenn das Smartphone oder die Festplatte den Geist aufgeben oder Clouds gelöscht werden. Sie bleiben stille Zeuginnen ihrer Zeit. So wie eine Karte aus dem Jahr 1918, die ich auf einem Flohmarkt in Kołobrzeg fand.
In Kołobrzeg (ehemals Kolberg) beendeten meine Freundin Claudia und ich nämlich im Sommer 2023 unsere Polenreise – eine Rundreise durch die Woiwodschaft Pommern, einst preußische, bis 1945 deutsche Provinz. Wir erkundeten den Landstrich, in dem Eltern von uns geboren wurden: ihre Mutter in Schneidemühl (heute Piła), mein Vater in Altschlage (heute Sława). Das Dorf, in dem mein Vater seine ersten Jahre verbrachte – 1945 floh die Familie vor den sowjetischen Truppen in Richtung Ruhrgebiet –, ist winzig geblieben: ein paar Häuser, umgeben von Feldern, Baumalleen und Stille. Auch wenn gerade zwei Jugendliche mit einem riesigen, donnernden Ghettoblaster die verkehrsfreie Kreuzung queren, ein paar Minuten an der vereinsamten Bushaltestelle herumlungern und dann wieder verschwinden. Sonst kein Mensch zu sehen. Das Gut, von dem mein Vater öfters gesprochen hat, steht offenbar nicht mehr. Wir fahren weiter.
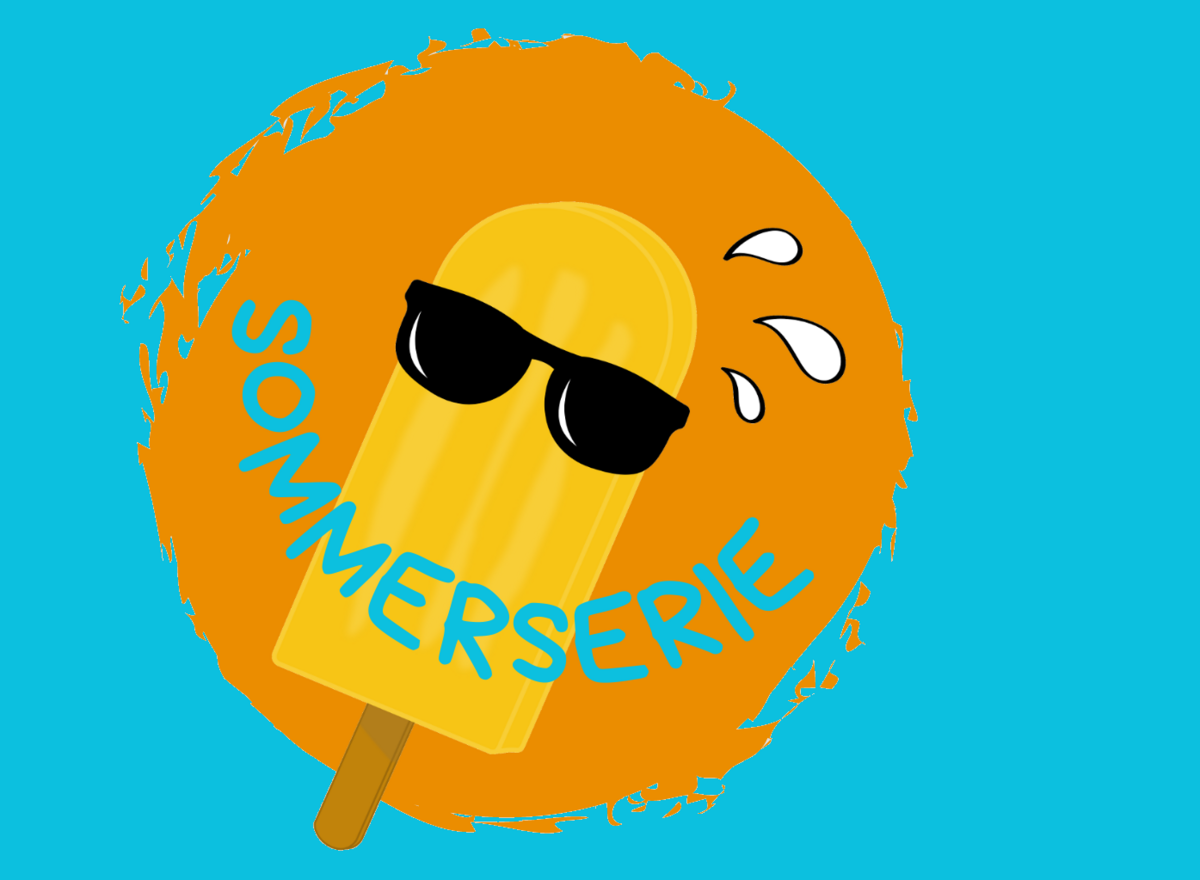





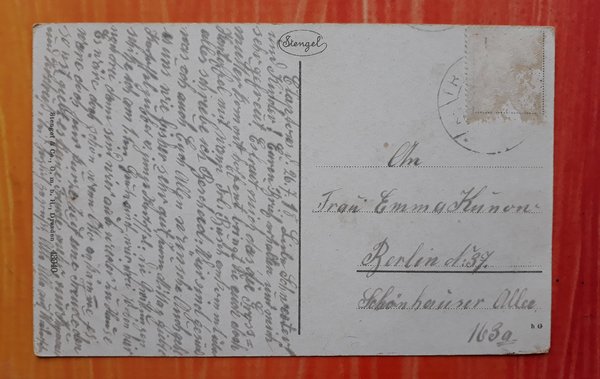






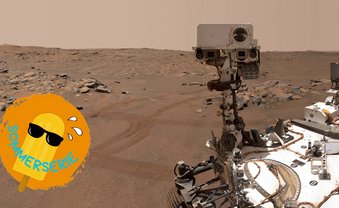




2 Kommentare verfügbar
-
Reply
Sehr interessant, danke schön!
Kommentare anzeigentarantandy
atWas eine Postkarte erzählen kann, zeigt auch folgender in Kontext erschienener Text:
https://www.kontextwochenzeitung.de/zeitgeschehen/238/stimme-aus-der-vergangenheit-3189.html