Das Jahr 1952, Arbeitslager Workuta in der Sowjetunion. Ein deutscher Gefangener schleicht sich nachts hinaus in die Kälte, kriecht über vereisten Boden, überwindet einen Zaun. Er will nicht fliehen, er will nur ins benachbarte Lager, um seine Frau und seine kleine Tochter zu sehen. Er schafft es auch, aber auf dem Rückweg wird er entdeckt, gestellt und trotz aller Erklärungsversuche erschossen. Seine letzten Worte: "Es lebe Genosse Stalin!" Nein, das ist nicht böse-ironisch gemeint. Auch wenn er und seine Frau Antonia (Alexandra Maria Lara), zwei deutsche Kommunisten im russischen Exil, in den späten 1930er Jahren Opfer der politischen "Säuberungen" wurden, auch wenn sie in den Denunziations- und Selbstzerfleischungsapparat der Partei und dann ins Lager gerieten, sind sie doch gläubig geblieben.
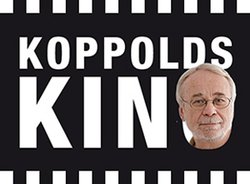
Und Antonia will auch im Jahr 1989 noch gläubig sein. Sie sitzt allein zu Haus – und dieses Zuhause ist in der DDR – und schaut mit skeptisch-müdem Blick auf Fernsehbilder von euphorischen Menschen beim Fall der Mauer. Ihr Telefon klingelt, anscheinend ein Anruf aus dem Westen, und sie sagt, ein bisschen defensiv, ein bisschen trotzig: "Willst du hören, dass du recht hattest?" Der Anrufer war Konrad, ein mit ihr befreundeter Arzt, der sie damals gefragt hatte, ob sie mit ihm nach Hamburg gehen wolle. Damals, das waren die frühen Jahre der DDR, als der Sohn des Staatspräsidenten Wilhelm Pieck sich dafür einsetzt, deutsche politische Gefangene aus der sowjetischen Lagerhaft zu entlassen. "Es sind unsere Genossen!"
Der Regisseur Bernd Böhlich, der mit seinen Geschichten vom dicken Wachtmeister Krause auf heimelig-verschmitzte Art vom deutschen Osten der Gegenwart erzählt, reicht nun mit seinem Film "Und der Zukunft zugewandt" einen Aspekt der DDR-Historie nach, der zumindest im Westen kaum bekannt sein dürfte. In der Bundesrepublik schafft es der Kanzler Konrad Adenauer etwa zur selben Zeit unter großem Jubel der Bevölkerung, deutsche Kriegsgefangene aus Sibirien zurück in die Heimat zu holen. In der DDR jedoch wird Antonia und ihrer Tochter zwar eine neue Wohnung in Fürstenberg zugeteilt, sie erhält Lebensmittelkarten und eine Arbeit als Organisatorin im Kulturbereich, aber sie muss einen Schweigevertrag unterschreiben. Was mit ihr und ihren Leidensgenossinnen passiert sei, das dürfe nie wieder passieren, sagt der Kulturfunktionär Silberstein (Stefan Kurt) und setzt hinzu: "Später können wir über alles reden, aber nicht jetzt." Tatsächlich will er auch später keine Rückschau halten, sondern immer nur die Zukunft sehen.
Öffentlich funktioniert Antonia – privat schweigt sie
Die DDR sieht sich in ihren frühen Jahren in schwer belagerter Verteidigungsposition. Es herrscht Kalter Krieg, das neu gegründete Land muss den Druck der USA und die Konkurrenz Westdeutschlands aushalten, es ist zudem extrem abhängig von der immer noch stalinistischen Sowjetunion. "Die Revolution ist kein Wunschkonzert", so formuliert das Silberstein. Oder so: "Wahrheit ist das, was uns nützt!" Deshalb hält auch die sehr ernste Antonia aus und durch, zieht sich zurück in ein öffentliches Funktionieren und in ein privates Schweigen, aus dem sie selbst mit dem Arzt Konrad (Robert Stadlober), der sie mal in einen Club mit Swingmusik führt, nur schwer herausfindet. Und mit dem ebenfalls um sie werbenden Silberstein, der ihr einen Fernseher in die Wohnung stellt, schon gar nicht.












2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Zu den Vergessenen gehören auch die Kommunisten, die Stalin während des Hitler-Stalin-Paktes aus der Sowjetunion an Nazi-Deutschland ausliefern ließ.
Kommentare anzeigenPhilippe Ressing
am 05.09.2019