Viele sehen die Paradebranche samt ihren Lieferanten mit mehr als 800 000 Beschäftigten untergehen. Zu hoch seien die Hürden, heißt es, die es zu überwinden gelte. Zu langsam und risikoscheu agierten die führenden Manager von Audi, BMW, Daimler, Bosch, Porsche. Schon bei der Schicksalsfrage der E-Mobilität, Batteriezellen made in Germany ja oder nein, mauerten sie unisono. Das Herzstück der Akkutechnik bezögen sie lieber aus Fernost. Das sei billiger und ginge schneller.
Spielt die Musik beim Auto der Zukunft also bald in Japan, Südkorea oder China? Verliert Deutschland durch diese Verweigerung eine ihrer wichtigsten industriellen Säulen? Für den Südwesten käme das einem Aderlass gleich, wie einst der Verlust der Montanindustrie für Nordrhein-Westfalen.
So abwegig ist diese Sorge keinesfalls. Seit den 1960er Jahren hat Deutschland ein Dutzend Branchen verloren, die einst zu den Weltbesten zählten – und stets auf ähnliche Weise. Begonnen hat das Sterben mit der Leder- und Modeindustrie, dann folgten die Hersteller von Motorrädern (NSU, DKW, Zündapp, Kreidler), Kameras (Zeiss, Agfa, Leitz) und Uhren (Kaiser, Kienzle, F. Mauthe, teilweise Junghans). In den 1980er Jahren strauchelten sämtliche Größen der Unterhaltungselektronik (AEG-Telefunken, Grundig, Bosch-Blaupunkt, Saba, Dual, Nordmende) sowie die Champions der Computer- und Büromaschinenindustrie (Olympia/AEG, Triumph-Adler, Mannesmann-Kienzle, Nixdorf). Und in den 1990ern erwischte es zunächst die Fabrikanten von Nachrichten- und Telekommunikationstechnik (AEG/TN, ITT/SEL/Alcatel, Detewe, Siemens, Tekade) und schließlich sämtliche deutschen Handy-Hersteller von AEG über Bosch bis Siemens. Der rasante Verfall der Solarbranche, überrollt von Chinesen, war Großteils die Folge politischer Fehlentscheidungen. Übriggeblieben von Zehntausenden Arbeitsplätzen und Hunderten Fabriken sind verblassende Marken und wenige Jobs in Deutschland. Bei Tablets, Smartphones, volldigitaler Telekommunikation sowie Solarzellen sind die Deutschen heute kaum präsent.
Eine bekannte Marke schützt nicht vor dem Untergang
Dieser Blick zurück zeigt: Größe, eine zeitweise hohe Marktmacht und eine bekannte Marke bewahren Unternehmen nicht vor ihrem völligen Verfall. Denn die Geschichte des Niedergangs ganzer Industrien lässt ein Muster erkennen, das sich stets wiederholte: Den Firmenspitzen fehlte das strategische Denken und der globale Überblick. Ihr Horizont reichte oft nur bis zum nächsten heimischen oder westlichen Wettbewerber. Die aggressiv-aufstrebenden Herausforderer und deren Strategien durchschauten sie kaum. Der große Bruch begann Mitte der 1970er Jahre mit dem Übergang von der arbeitsintensiven analogen Technik zu digitalen Systemen mit Software und IT-Fachkräften. Während deutsche Bosse viel zu lange an der geliebten Mechanik und Elektrotechnik festhielten, setzten die Newcomer aus Asien alle Kraft auf den Siegeszug der Digitalisierung ihrer neuen Produkte. Und das waren und sind preiswerte, haltbare Massenware im Weltmarktstil.




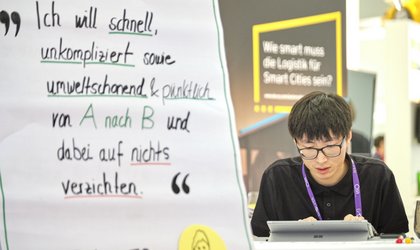












2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Eine sehr exakte und genau treffende Analyse der aktuellen Probleme deutscher Firmen.
Kommentare anzeigenMIchael Wenzel
amMan "ist nicht mehr " beim Kunden und dessen Wünschen und beharrt zudem an überkommenen Techniken. Diese Leute haben keine Vision !