Ja wo sind denn die Pferde? Auf dem Triebweg von Stuttgart-Feuerbach nach Weilimdorf ist lange nichts zu entdecken. Da ertönt ein gedämpfter Ruf, und bald sieht man sie: Julian Sartorius zieht mit seinem Rappen Nick Baumstämme aus dem Wald. Der 950 Kilogramm schwere Kaltblüter der französischen Rasse Percheron ist ein Rückepferd, er transportiert gefällte Baumstämme innerhalb des Waldes. Nick kann ohne Weiteres ein Viertel seines Eigengewichts ziehen, erklärt der Gärtner und Pferdehalter Sartorius. Das Tier ist kaum zu bremsen, weiß aber noch nicht, wohin zwischen all den Bäumen. Altpferde fänden den Weg fast alleine.
Nachdem Rückepferde in den 1960er-Jahren zunehmend von landwirtschaftlichen Maschinen verdrängt wurden, sind sie nun langsam wieder auf dem Vormarsch, wenn es um nachhaltige Forstwirtschaft geht. Sie sind aber nur ein Baustein in der neuen Waldstrategie der Stadt Stuttgart, die der Gemeinderat vor drei Jahren beschlossen hat. "Klimastabilität, Schutzwirkung und Erholungsvorsorge" sind nach der neuen Zielsetzung der Stadt wichtiger als die Holzproduktion. Als einzige Stadt im Südwesten hat Stuttgart seit 2019 einen Waldbeirat. Die Bürgerinitiative Zukunft Stuttgarter Wald hat den Stein ins Rollen gebracht.
Am Wald scheiden sich die Geister. Die Forstwirtschaft beharrt darauf, den Begriff der Nachhaltigkeit erfunden zu haben. Aber die Trockensommer 2018 und 2019 haben gezeigt, dass es so wie in den letzten 200 Jahren nicht weitergehen kann. 245.000 Hektar Wald sind in diesen beiden Jahren abgestorben – 2,1 Prozent der gesamten deutschen Waldfläche. Besonders betroffen sind Monokulturen mit Nadelbäumen, die kaum dürreresistent sind. Der Fichte, bisher Holzlieferant Nummer eins, geben auch Anhänger der konventionellen Forstwirtschaft keine Zukunft mehr.
















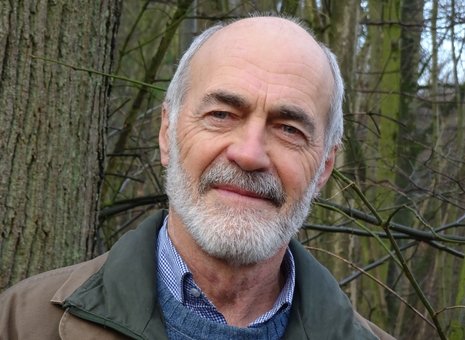










4 Kommentare verfügbar
-
Reply
Danke für den im wesentlichen guten Artikel. Es ist am Ende eine ziemlich gevagte Behauptung, "Ein Großteil des Holzeinschlags dient zunehmend als Brennholz". Zumindest gehört "Großteil" und "zunehmend " gründlich recherchiert. Auch der Satz "Wegen seiner geringeren Energieeffizienz setzt Holz beim…
Kommentare anzeigenRobert Bauer
at