Hamburg macht es vor. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte 2023 seine Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) zum Informationsaustausch nach Hamburg geschickt, um sich Tipps vom Aufsteiger in allen Bildungsvergleichsstudien zu holen. Jetzt könnte Landesumweltministerin Thekla Walker (ebenfalls Grüne) folgen, am besten im Geleitzug mit jenen ihrer CDU-Kolleg:innen am Kabinettstisch, die bremsen und blockieren, wenn es um die dringend gebotenen schärferen Maßnahmen zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes geht.
Denn in der Hansestadt hat in einem Volksentscheid die Mehrheit für konkrete Verschärfungen im Kampf gegen die Erderwärmung votiert. Damit muss die Bürgerschaft mit ihrer rot-grünen Mehrheit das zugrunde gelegte geänderte Klimaschutzgesetz jetzt annehmen. Wie weichenstellend dieser Erfolg ist, zeigen die ersten Reaktionen. "Fridays for Future siegt in Hamburg und bestimmt jetzt die Klima-Politik", barmt die "Welt". Tatsächlich werden die Auswirkungen bundesweit ausstrahlen. Nicht nur das Ziel, emissionsneutral zu werden, ist in Hamburg nun von 2045 auf 2040 vorgezogen. Bei Verfehlungen auf dem Weg dahin muss zeitnah mit zusätzlichen Maßnahmen reagiert werden, und vor allem müssen entsprechende Einschnitte oder Förderprogramme sozial gerecht ausgestaltet sein. Noch am Abend der Auszählungen drohten Wirtschaftsverbände mit Abwanderungen.
Dass die Klima-Entwicklung auch in Baden-Württemberg nach immer rascheren Reaktionen verlangen, weil die Lage immer bedrohlicher wird, beschreibt ein einziger Tatbestand. "Die zu erbringende Minderung der Treibhausgas-Emissionen in den sechs Jahren von 2025 bis 2030 ist fast genauso hoch wie die in den vergangenen 34 Jahren erbrachte Minderung", erläuterte Maike Schmidt, die Vorsitzende des Klima-Sachverständigenrates. Das gesetzlich verankerte Gremium hat vergangene Woche seinen aktuellen "Fortschrittsbericht" vorgelegt. Die Herausforderungen seien heute noch größer als ursprünglich angenommen.
Arme sind weniger schuld, aber stärker betroffen
"Wir sind zutiefst besorgt", sagt die Fachfrau, im Hauptberuf Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg. Zumal wenn der Klimawandel aus einem bisher vernachlässigten Blickwinkel betrachtet wird, dem Gerechtigkeitsaspekt. "Die soziale Frage wurde im 20. Jahrhundert als gesellschaftliches Gesamtprojekt angegangen", schreiben die sechs Autor:innen, "und in ähnlicher Weise erfordert die ökologische Frage beziehungsweise Klimafrage, dass sie solidarisch gelöst wird. Denn werden soziale Gerechtigkeitsaspekte bei der Entwicklung von Maßnahmen vernachlässigt, riskiert die Politik das Gesamtprojekt der Klimaneutralität."
Wer arm ist und deshalb in weniger begrünten Quartieren lebt, in schlecht gedämmten Häusern wohnt und sich weniger gesund ernähren kann, ist von der Erderwärmung deutlich schneller und stärker betroffen. Dabei stoßen Ärmere deutlich weniger Traibhausgas aus – wegen kleinerer oder gar keiner Autos, keiner Flugreisen, schon gar keiner Villen. "Der ökologische Fußabdruck von Menschen mit geringem Einkommen ist nur halb so groß wie der von Menschen der mittleren Einkommensgruppen in Deutschland", rechnet Schmidt vor. Die Menschen in den höchsten Einkommensgruppen hätten "sogar einen bis zu dreimal größeren ökologischen Fußabdruck und damit auch einen bis zu dreimal so hohen CO₂-Ausstoß wie die unteren".








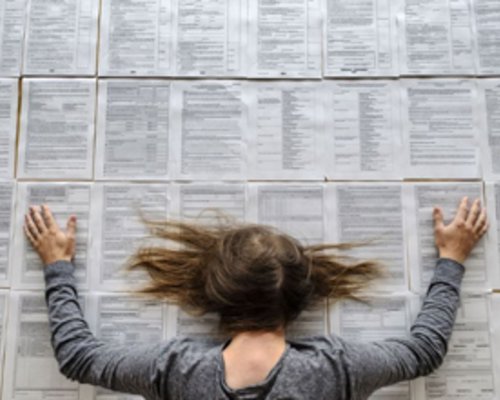









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!