Desinformation galoppiert, Zusammenhänge gehen unter. Ohne größeres Echo verweisen alle vier kirchlichen Wohlfahrtsverbände nach zwei Jahren Bürgergeld darauf, dass deutlich mehr Menschen dessen Bezug längst nicht mehr nötig hätten, wären die Jobcenter finanziell angemessen ausgestattet, "um unterstützende Angebote zur Beratung, Beschäftigung und Qualifizierung in den betreffenden Einrichtungen umzusetzen und auszubauen". Das Bürgergeld sei in seiner Grundidee Ausdruck verbesserter Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, um die umzusetzen fehle es aber an Geld. Arbeitslose oder Geringverdienende können deshalb nicht qualifiziert und vermittelt werden, bleiben also angewiesen auf die Stütze.
Nur zur Erinnerung: Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 musste die Regierung Scholz ziemlich hastig Löcher im Etat des Bundes von rund 17 Milliarden Euro stopfen. Sogleich nahm die Union Sozialausgaben ins Visier, und in Bayern wollte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Bundesrat eine sich aus Existenzminimum und Inflation logisch ergebenden Bürgergeld-Erhöhung ab Januar 2024 verschieben. Eine Mehrheit in der Länderkammer wollte das nicht, aber das populistische Gift träufelte. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) versuchte mehrfach dagegenzuhalten und warnte davor, unter dem aktuellen Spardruck gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen, Ressentiments zu schüren und Menschen unter Generalverdacht zu stellen: Das dürften demokratische Parteien niemals.
Da waren CDU und CSU und in der Folge auch die FDP aber schon von der Fahne gegangen. Dabei stellten die Liberalen mit Marco Buschmann den Bundesjustizminister, der hätte erklären können, dass Karlsruhe sich nicht nur mit dem Haushalt, sondern in jüngerer Vergangenheit mehrfach mit dem finanziell Lebensnotwendigen befasst und für Verschiebungen oder gar Kürzungen keinen Spielraum gelassen hat. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur geht diese Botschaft ebenso unter in immer neuen Aufwallungen, die angeheizt werden durch Parolen wie diese: "Es ist völlig klar, dass der Sozialstaat in Deutschland zu viel Geld kostet." Die neoliberale Offenbarung stammt vom damaligen FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Der ist zwar Geschichte, aber seine unbelegte Behauptung hat sich eingefräst. Ließe Faktenferne lange Nasen wachsen, wäre Deutschland inzwischen voller Pinocchios.
Geradezu flehentlich argumentieren die Sozialverbände mit Erfahrungen aus der eigenen Tätigkeit. "Wir beraten unterschiedlichste Gruppen von Menschen, die Grundsicherungsleistungen beziehen", schrieb die Caritas vor einem Jahr – ausdrücklich um die Debatte zu versachlichen. Nicht selten seien Menschen durch prekäre Lebensbedingungen, durch das Scheitern von Bildungswegen und Schicksalsschläge entmutigt und in der Aufnahme einer Erwerbsarbeit behindert. "Viele Grundsicherungsbezieher sind erwerbstätig, aber der Lohn reicht nicht aus, entweder, weil sie geringfügig oder in Teilzeit arbeiten oder weil ihr Arbeitsentgelt trotz Vollzeittätigkeit nicht reicht, um die Familie durchzubringen", heißt es weiter. Die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip der Verfassung sichere allen Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, das soziokulturelle Existenzminimum zu, und zudem sei das Bürgergeld ohnehin nur das unterste Netz zur Existenzsicherung.
Gegen "die da unten" in Stellung gehen
Analysen, Studien und gute Gründe fruchten so wenig wie Faktenchecks und Statistiken. Zu große Teile der Bevölkerung – nur dürftig oder gar nicht informiert – lassen sich gegen "die da unten" in Stellung bringen. Nur ein Beispiel von vielen: Jede Debatte um die sogenannten Totalverweigerer hätte beendet sein müssen, als die Bundesagentur für Arbeit auf Anfrage der "Tagesschau" mitteilte, dass in den ersten elf Monaten 2023, also seit Inkrafttreten, nur gegen 13.838 Menschen Sanktionen verhängt wurden, weil sie eine Arbeit, Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation oder ein Angebot der Agentur nicht aufnehmen oder fortsetzen wollten. Doch wer lieber seine Vorurteile hätschelt und deswegen jegliches überschlägiges Rechnen überflüssig findet, kann in solchen Zahlen eine bedrohliche Belastung für das Gemeinwesen sehen.





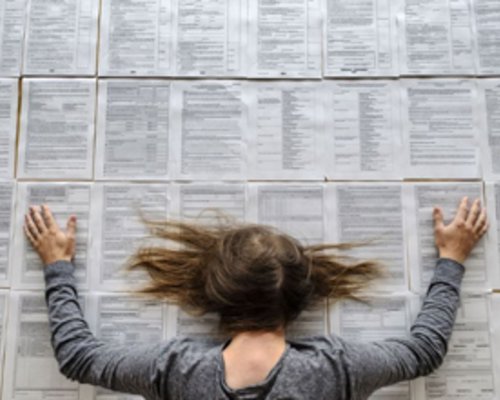







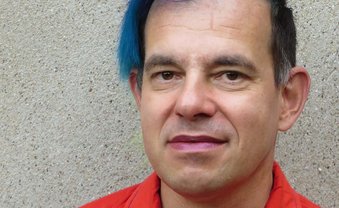


3 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Das Bürgergeld wird die Gesellschaft leider weiter spalten, denn die offziellen Zahlen von 31 Milliarden EUR für das Bürgergeld im Jahr 2023 offenbaren ja nur die halbe Wahrheit. Weitaus höher sind heute die Zahlungen für Miete und sonstige Nebenkosten. Die echten Kosten sind also im Sicherheit…
Kommentare anzeigenReinhard Gunst
am