Von einem modernen Staat mag es sehr unterschiedliche Vorstellungen geben. In den laufenden Koalitionsverhandlungen brachte die Arbeitsgruppe 9 von Union und SPD ihre Absichten dazu zu Papier. Für die Union ist es demnach modern, die Freiheit der Information einzuschränken. So heißt es im Ergebnispapier: "Der Bundestag muss die Regierung und die Verwaltung effektiv kontrollieren können. Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen." Da die SPD das nicht mittragen will, sind die Parteispitzen in Sachen moderner Staat nochmals zum Nachsitzen verdonnert.
Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wurde von Union und SPD unter Kanzlerin Angela Merkel 2006 für Bundesbehörden eingeführt. Es soll politische Entscheidungen und Verwaltungshandeln für Bürger:innen nachvollziehbarer machen. Jede:r kann Anfragen stellen und Einsicht in amtliche Dokumente nehmen. Das betrifft zum Beispiel Statistiken, Vermerke, Protokolle, Verträge oder Bescheide. Ausgeschlossen sind dagegen Dokumente, die als vertraulich gelten, Entwürfe oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Mittlerweile gelten diese Rechte auf Information in ähnlicher Form auch in allen Bundeländern außer Bayern und Niedersachsen.
Werkzeug für Kontrolle und Aufklärung
Allein über die Plattform FragDenStaat stellten Bürger:innen in den vergangenen 20 Jahren fast 300.000 Anfragen an Behörden. Zwar nutzten viele Behörden die zahlreichen Ausnahmeregeln und blieben Antworten schuldig. Manche nutzten das IFG jedoch, um ihr Handeln besser zu erklären. Nicht zuletzt wurden mit Hilfe des IFG auch einige Skandale aufgedeckt, darunter der Maskendeal des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU), die PKW-Maut von Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) oder Einzelheiten zum Cum-Ex-Skandal. In einigen Fällen mussten Gerichte die Herausgabe der Unterlagen erst durchsetzen.
Einer der Leidtragenden der Informationsfreiheit war – und ist – ausgerechnet der Verhandlungsführer der CDU in der Arbeitsgruppe zur Staatsmodernisierung, Philipp Amthor. Sein schneller politischer Aufstieg wurde 2021 jäh gebremst, als der Verdacht aufkam, er habe seine politische Position für wirtschaftliche Zwecke genutzt. Eine IFG-Anfrage zwang das Bundeswirtschaftsministerium, einen Brief Amthors offenzulegen. Auf dem Briefpapier des Deutschen Bundestags bat Amthor den damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), sich mit dem Gründer des US-amerikanischen Start-Up-Unternehmens Augustus Intelligence zu treffen. Ein Unternehmen, von dem Amthor später Aktienoptionen und eine Direktorenstelle erhielt.
Wie für viele Journalist:innen gehört das IFG inzwischen auch für Kontext zum Handwerkszeug. Aber so, wie das Gesetz momentan gebaut ist, reicht ein Antrag allein nicht. Wer Informationen will, braucht Geduld, präzise Formulierungen und ein gutes Gespür für Verwaltungsprozesse. Informationen zu bekommen, bedeutet im IFG, sie sich zu erarbeiten.
Dokumente unterstützen journalistische Recherche
Zuletzt nutzte Kontext das Instrument, nachdem auch in anderen Medien und in der Politik die Kritik an einer "Hinterzimmerpolitik" im Karlsruher Rathaus lauter wurde. Die Stadtverwaltung verweigerte selbst dem Gemeinderat Einsicht in Dokumente und Verträge der Stadt mit dem Immobilieninvestor Christoph Gröner, der auch bei Kontext mit der Majolika-Manufaktur und stillstehenden Bauprojekten regelmäßig Schlagzeilen macht. Im Juli 2024 forderte Kontext daher unter Berufung auf das baden-württembergische IFG Einblick in Kalender, Protokolle, Vermerke, Gutachten und anderen Schriftwechsel an, die zwischen Stadtverwaltung und Immobilienkonzern ausgetauscht wurden.










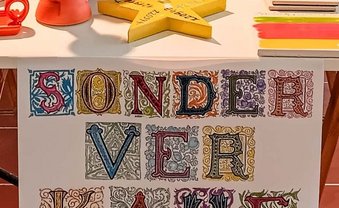


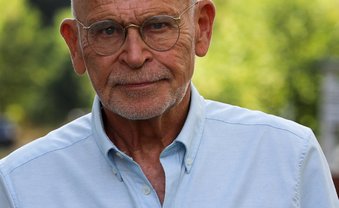


4 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Ich denke ja immer noch die Politik hat eine Bringschuld was Informationen angeht. Von daher sollten alle Informationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Das geht ja mittlerweile auch ganz gut und barrierefrei - wenn es denn gewünscht sein sollte.
Kommentare anzeigenCathrin
vor 3 WochenAuch alle Geschäfte die mit Steuergeld…