Mit nur acht Worten hatten Grüne und CDU 2021 einen Pflock eingerammt in der traditionell hoch umstrittenen Schulpolitik. "Keine Strukturdebatte", heißt der gute Vorsatz im Koalitionsvertrag, präzise und knapp formuliert wie nur wenige andere Punkte: "Das achtjährige Gymnasium bleibt die Regelform." Gut zwei Jahre und 106.950 Unterschriften später ist der Pflock gefällt und nolens volens damit die Absicht Geschichte, sich Strukturdebatten eine zweite Legislaturperiode lang vom Leib zu halten. Gerade noch rechtzeitig vor Ferienbeginn hat die Ministerin alle Schulen über die für sie relevanten Veränderungen informiert, teilweise ausgelöst durch die Wiedereinführung von G9. Meilenweit bleiben die Maßnahmen vor allem ab der fünften Klasse aber hinter dem zurück, was in Praxis und Wissenschaft als dringend notwendig angeraten wird.
Ein Grund dafür liegt in den vergangenen acht Jahren. Seit die Schwarzen mit in der Landesregierung sitzen, finden ehrliche bildungspolitische Analysen, orientiert an internationalen Erkenntnissen, kaum Gehör. Viel Zeit ist ungenutzt verstrichen. Die CDU gefiel sich darin – kraftvoll unterstützt von der FDP –, schlechtes Abschneiden in Vergleichsstudien vor allem jenen grün-roten Bemühungen anzulasten, die endlich Erkenntnisse aus dem Ausland nach Baden-Württemberg importieren sollten. Denn längst ist bekannt und belegt, dass längeres gemeinsames Lernen und Lehren der Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit ist – eine Einsicht, die Gymnasialeltern und solche, die es werden wollen, aber ziemlich kalt lässt.
Eben erst haben Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen, unterstützt von der Robert-Bosch-Stiftung, ihr Konzept "Neue Sekundarschulen für Baden-Württemberg" vorgelegt. Auf 72 Seiten ist zusammengefasst, wohin die Reise tatsächlich gehen müsste. Die Profis betonen, dass die Rückkehr zum G9 die gesamte Schullandschaft betrifft, und wollen diese Schullandschaft umgestalten. Neben dem neunjährigen Gymnasium soll es nur noch eine zweite Säule geben und so eine bessere, modernere Schule für alle Kinder und Jugendlichen entstehen, statt nur für Gymnasiast:innen. Konkret werden zur Erprobung der Neuen Sekundarschule Pilotstandorte verlangt, schon in fünf Jahren könnte dann diese zweite Säule neben dem Gymnasium ab der fünften Klasse grundsätzlich starten.
Expert:innen werden ignoriert
Wohlbegründet ist zudem eine "gemeinsame Orientierungsstufe in den Klassenstufen fünf und sechs als konstitutiver Bestandteil" der neuen Sekundarstufe vorgeschlagen. Ziel sei, "einerseits ein gelingendes Ankommen an der weiterführenden Schule zu ermöglichen und den Schüler*innen eine soziale Beheimatung zu bieten, andererseits die in der Primarstufe erworbenen Basiskompetenzen auszubauen und zu sichern, um so verlässliche Grundlagen für den weiteren Bildungsweg zu ermöglichen". Sitzen bleiben am Ende der Fünften ist übrigens nicht möglich. Grün-Schwarz geht einen ganz anderen Weg. Eine Zusammenführung aller Schulformen neben dem Gymnasium wird nicht mal angedacht.












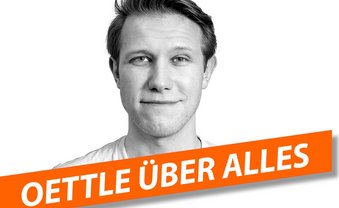



2 Kommentare verfügbar
-
Antworten
"Vorteile des längeren gemeinsamen Lernens"
Kommentare anzeigenWolfgang Kühnel
amDiejenigen, die für eine 6-jährige Grundschule plädieren, verweisen merkwürdigerweise nie auf den großen Erfolg eben dieser 6-jährigen Grundschule in Berlin, wo sie seit dem 2. Weltkrieg besteht -- deutlich abweichend von den westlichen Bundesländern. …