Ein akustisches Phänomen! Der Gesangswissenschaftler Christian T. Herbst stellt fest: "Es wurde eine mittlere Sprechstimmlage von ungefähr 109 bis 128 Hertz und ein Singstimmumfang von drei Oktaven (G bis g'', ca. 98 – 784 Hz) festgestellt. Freddie Mercury war von der Sprechstimmlage her Bariton, sang jedoch meistens in Tenorlage. Das Stimmtimbre zeigte sich sehr variabel. Freddie Mercury sang sowohl im Brust- als auch im Falsett-Register, der Grad der glottischen Adduktion wurde abhängig vom ästhetischen Kontext entlang der Dimension 'behaucht'/'gepresst' variiert. Die Stimme hatte ein unregelmäßiges und schnelles Vibrato (ca. 7 Hz) mit relativ weiter Auslenkung (ca. 1.5 Halbtöne). Das stellenweise 'raue' Stimmtimbre ist auf subharmonische Oszillations-Phänomene (Periodenverdopplung, -verdreifachung und -vervierfachung) im Larynx zurückzuführen." Nach diesem kleinen Ausflug in die Wissenschaft (und in die Langeweile) aber wieder zurück zum Film, der "glottische Adduktion" oder "Oszillationsphänomene" Gott sei Dank nicht analysiert und benennt, sondern in ihrer Wirkung vorführt.
Malek fehlt Mercurys Sex-Appeal
Es ist also jede Menge Freddie Mercury zu hören. Zu sehen ist dabei der Schauspieler Rami Malek, der mit der SF-Serie "Mr. Robot" bekannt wurde und im Remake von "Papillon" die Dustin-Hoffmann-Rolle übernommen hat. Wie Malek sich als Mercury aufführt, von den androgynen und an Glam-Rock erinnernden Auftritten zu Beginn bis hin zum markanten Schnurrbart- und Ledermann der Wembley-Zeit, wie er dabei dessen zurückhaltende, fast scheue private Momente genauso erfasst wie das Sich-selber-unter-Strom-Setzen und öffentliche Energie-Verschleudern ("Auf der Bühne bin ich ganz die Person, die ich sein will!"), das ist von verblüffender Präzision. Und dennoch wird Malek nicht wirklich zu Mercury, es fehlt ihm ein bisschen das, was dieses Bühnentier eben auch noch ausmachte, etwas, das man früher vielleicht als Sex-Appeal bezeichnet hätte, eine erotische Aufladung also, eine wenn schon nicht ausgesprochene, so in den exzessiven Posen doch zu erkennende Aufforderung zu dem, was Lou Reed als "Walk on the wild Side" bezeichnet hat.
Aber das ist nicht Rami Maleks Fehler, das ist die Absicht des Films. Die kantigeren, komplexeren und manchmal auch verstörenden Seiten von Freddie Mercury (die Münchner Jahre etwa spielen keine Rolle) werden hier in den Mainstream hinein geglättet. Keine schillernden Abgründe, keine störenden Ambivalenzen, keine Experimente und auch keine Improvisation: "Bohemian Rhapsody" will ein Film für (fast) alle sein, er erzählt auf brave Art von einem exzessiven Leben, und deshalb deutet er die Sexualität des Stars (bei dem es ja tatsächlich nie ein Coming Out gab) auch nur durch verlangende Männerblicke an, steigt aber, nachdem etwa bei einer US-Tournee ein viriler Trucker ins Klo vorangeht, vor der Tür keusch aus. Wenn Freddie Mercury seiner treuherzigen Freundin Mary (Lucy Boynton) dann gesteht, er sei bisexuell, und wenn sie danach zwar auszieht, aber nun gegenüber wohnt und Lichtzeichen mit ihm austauscht, dann wirkt das fast wie eine Hommage ans alte und bittersüße Melodram.
Unterkomplex, aber unterhaltsam
Zu diesem Zeitpunkt hat der musikalische Eklektiker Freddie Mercury sich von Queen getrennt und versucht sich erfolglos an einer Solo-Karriere. Spätestens jetzt wird auch klar, dass "Bohemian Rhapsody" eben kein Queen-Film ist – obwohl Gwilym Lee als Brian May, Ben Hardy als Roger Taylor und Joseph Mazzello als John Deacon durchaus prägnante Szenen gegönnt sind – sondern ein Freddie-Mercury-Biopic. Das erzählt nun, nicht besonders subtil, sondern in vorgefertigten Genrebausteinen, die Story vom "poor little rich kid", das einsam in seiner großen Villa verkümmert und sich unterm Kronleuchter mit Koks volldröhnt. Dass er so selbstherrlich-arrogant und so blasiert-divenhaft geworden ist, das wird im Film übrigens seinem intriganten Lover und Manager (Allen Leech) zugeschrieben, einer in ihrer eindeutigen Schurkenhaftigkeit ebenfalls sehr melodramhaften Figur. Doch bei aller Kritik an diesem, vorsichtig gesagt, unterkomplexen Film muss man zugestehen: Er ist ganz unterhaltsam.
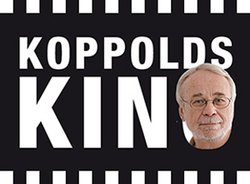















1 Kommentar verfügbar
-
Reply
Egal welches Drehbuch, egal welches Storyboard - niemand kann es schaffen in einem Kinofilm einer solchen Ausnahmepersönlichkeit "gerecht zu werden". Wahrscheinlich würde allein der Versuch einen Film über ihn ruinieren. Und wer könnte sich anmaßen, alle Facetten überhaupt je zu Gesicht bekommen zu…
Kommentare anzeigenAndrea K.
at