Wenn man in einem Film, sagen wir mal über Van Gogh, als erstes ein Bild von Gauguin präsentiert bekäme, wäre man etwas irritiert. Etwa so wie in diesem Film über das Bauhaus, der zum Auftakt ein Gebäude des Bauhaus-Konkurrenten Le Corbusier zeigt und dieses auch noch ausführlich vorstellt. Es ist die zwischen 1947 und 1951 entstandene, 56 Meter hohe, 165 Meter lange und nicht ganz unumstrittene Wohnmaschine "La Cité Radieuse" in Marseille, bei der ein Erzähler von "menschlichem Maß" spricht und eine zufriedene Bewohnerin einen Blick in die Räume gewährt. Danach findet Niels-Christian Bolbrinkers und Thomas Tielschs Dokumentarfilm "Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus" aber doch den Weg zu den Anfängen jener experimentellen Institution, die Walter Gropius 1919 in Weimar gründete, die später nach Dessau zog, sich dann unter dem Druck der Nazis auflöste und trotzdem weiter und nun auch weltweit das moderne Bauen beeinflusst.
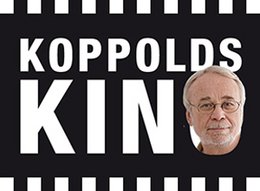
Doch das Bauhaus war weit mehr als nur eine Architektur-Schule, es ging Gropius und seinen Mitstreitern, darunter etwa Johannes Itten, Paul Klee und Wassily Kandinsky, um ein Zusammendenken und -führen von Handwerk, Kunst und Bauen, es ging ihnen also um ein interdisziplinäres Projekt. In den Fotos und Filmen, die das Regie-Duo Bolbrinker und Tielsch aus den Archiven ausgegraben hat, ist beides spürbar: eine schöpferische Euphorie, die aus alten Zwängen hinaus ins Freie und in die Zukunft drängt, und ein bisschen auch ein ins Sektiererische hineinwabernder Gruppengeist, der sich die Welt als Spielwiese ausmalt. In gewichtig raunendem Ton verkündet der Erzähler: "An jedem Weg liegen Perlen", spricht aber auch von einem "esoterisch gefärbten Konzept". Gemeinsam wohnen, arbeiten und feiern, das gehörte beim Bauhaus zusammen und kulminierte in legendären Festen. Dass das Apartmenthaus der Bauhausmitarbeiter extrem hellhörig war, wird im Film als gewollt (v)erklärt, es habe die Kommunikation begünstigt.





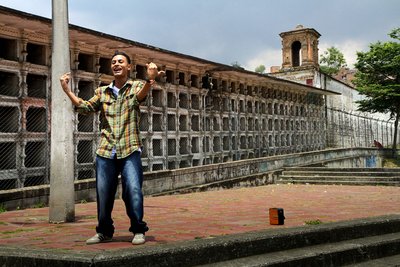











0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!