"Im März 1964 war ich Chauffeur von Che Guevara", erzählt der bebrillte ältere Herr aus der Schweiz, der eigentlich so aussieht, als wäre er auf dem Weg zur Bank, um sich um seine Aktienfonds zu sorgen. Aber dieser 1934 in Thun geborene Jean Ziegler ist tatsächlich ein Rebell und gefährlicher Gegner der Banken und des Finanzkapitals. Sein bürgerlicher Habitus ist nur Tarnung, um in Seminaren, Parlamenten oder UN-Ausschüssen gehört zu werden. Wer sich im Reich der Diplomatie, jener "Welt ohne Mitleid", nämlich nicht an die Regeln halte, der sei bald draußen und ohne Einfluss. "Deshalb wechsle ich Sprache, Gestus, Aussehen, alles", sagt der polyglotte Ziegler, der lange im Schweizer Nationalrat saß, von 2000 bis 2008 als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung arbeitete und seither im Beratenden Ausschuss für den UN-Menschenrechtsrat tätig ist.
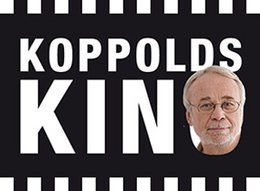
Als der junge Ziegler damals auf einer internationalen Konferenz Che Guevara trifft und ihn zwölfeinhalb Tage lang durch Genf begleitet, will er sich dem charismatischen Berufsrevolutionär sofort anschließen. Doch Guevara ist dagegen, Ziegler solle sich vielmehr in die "Institutionen einschleichen", sein Platz sei hier, im "Kopf des Monsters". Man muss inzwischen konstatieren: Wenn einem der lange Marsch durch die Institutionen gelungen ist, ohne dabei zu dem zu werden, was er eigentlich bekämpfen wollte, dann ist es dieser Jean Ziegler. Für ihn, der taktisch und strategisch denkt, aber immer direkt angreift und nie mit den Waffen von Ironie und Sarkasmus, ist das Finanzkapital die wahre Weltmacht und die Staaten, selbst die mächtigsten, sind nur "Befehlsempfänger und Handlanger der Konzerne." Was für Ziegler aber kein Grund zur Resignation ist, sondern nur Ansporn, die Verhältnisse grundlegend zu verbessern.
Der Regisseur Nicolas Wadimoff, der diesen Dokumentarfilm gedreht hat, war selbst mal Student von Ziegler, und dass er mit dem Porträtierten nach wie vor sympathisiert, will er gar nicht verbergen. Was jedoch nicht heißt, dass Wadimoff auf kritisches Nachfragen verzichtet. Zunächst allerdings erhält der Porträtierte Zeit und Raum, seine Sicht der Welt vorzustellen und auch seine Motivation, sie zu verändern. Als Ziegler auf dem Weg zu einer Konferenz auf dem Rücksitz eines Wagens Akten liest, eine Rede durchgeht, Sätze anstreicht, kramt er plötzlich alte Fotos hervor und zeigt sie in die Kamera. Es sind schockierende Bilder von kranken afrikanischen Mädchen. Er kenne die Täter, sagt Ziegler. Diese Bilder seien für ihn Motivation, wenn ihm mal alles zu viel werde, er habe sie deshalb immer dabei. "Und die Erklärung der Menschenrechte!"
"Nur der Zufall der Geburt unterscheidet uns"
Dann blendet der Film zurück, liefert biografische Daten und Bilder aus Zieglers Leben, erzählt aus dem Off von einer behüteten Kindheit, von Wiesen und Bergen und dem prägenden Motto "ora et labora", von einem Vater, für den die Welt wohl geordnet war und jeder an seinem Platz, und vom Sohn, der sieht, wie Waisenkinder Zwangsarbeit auf den Feldern verrichten müssen, und der Ungerechtigkeiten erkennt. "Er verweigert sich diesem Glück, das ihn erstickt", fasst der Regisseur diese Zeit zusammen, nach der Ziegler auszieht, um das Rebellieren zu lernen. Er studiert in Bern und Genf Jura und Soziologie; freundet sich in Paris mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir an und schreibt für deren Zeitschrift "Les Temps Modernes"; wird im Kongo als UN-Experte Zeuge, wie der ermordete Präsident Lumumba durch Mobutu ersetzt wird, einem mit Hilfe der USA installierten Diktator. "Nichts unterscheidet uns von den Opfern", sagt Ziegler, "nur der Zufall der Geburt." Von nun an unterstützt Ziegler Befreiungsgruppen in aller Welt, von Algerien, über Chile und Nicaragua bis hin zu Burkina Faso.

















0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!