Dieses Mysterium ist Ausfluss erfolgreichen Kalküls. Gezielt sucht Kosminski die Nähe von Politikern und einflussreichen Theaterschaffenden, pflegt weniger die Regiekunst als nützliche Kontakte. Mit Mannheims Oberbürgermeister duzt er sich und Matthias Lilienthal, damals als designierter Intendant der Münchner Kammerspiele umschmuster Liebling der Szene, diente er 2014 bei der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft im Werkhaus des Nationaltheaters als Trabant: Jeweils nur kurz konnte sich Lilienthal der hartnäckigen und von Teilnehmern amüsiert registrierten Fürsorge des Gastgebers entziehen, wenn dieser sich auch Ulrich Khuon – Intendant des Deutschen Theater Berlin und später Mitglied just jener Findungskommission, die Kosminski einstimmig für Stuttgart vorschlug – zuwandte.
Sogar das Rahmenprogramm seiner Sparte mutet an, als ziele es vor allem auf die Anwerbung von Politprominenz ab. Kürzlich weilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur ersten Auflage der "Mannheimer Reden" am Rhein. Wie Kosminskis Pressesprecherin das neue Format erläutert, ist von unfreiwilliger Komik: "Ein Anstoß des Nationaltheaters Mannheim in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Mannheim Dr. Peter Kurz; Medienpartner: Mannheimer Morgen." Mehr Establishment geht wirklich nicht.
Nicht vom Geist der Opposition getrieben
Dagegen wäre weniger zu sagen, wenn es der Sache diente. Nur hat sich das Wirken des passionierten Öffentlichkeitsarbeiters längst verselbstständigt: Seine Entscheidungen und Initiativen fördern nicht das Theater, sondern ihn. Kosminski verkauft sich selbst. Dort, wo Friedrich Schillers Protest-Drama "Die Räuber" 1782 uraufgeführt wurde, entstellt sich heute bis zur Kenntlichkeit ein Kunstverständnis, das nicht vom Geist der Opposition getrieben, sondern von Anpassung und Anbiederung zersetzt wird.
Wobei Tatsachen bedarfsweise zur Dispositionsmasse und damit zu Kollateralschäden mutieren. Mitunter verfängt sich Kosminski bei der Eigenvermarktung in Superlativen. Wie vor drei Jahren, als er – bislang sein alarmistisches Meisterstück – in einem Brandbrief an mehrere Minister mit gravitätischem Credo, dramatisch veredeltem Parlando und avantgardistischer Interpunktion den angeblich drohenden Untergang der deutschen Bühnenlandschaft vorhersagte. Discite moniti: Lernt, Ihr Ermahnten! Vergils "Aeneis" hätte die Blaupause sein können. Aber schon der zweite Satz, mit dem Kosminski sein Haus nonchalant zum "ältesten kommunalen Theater der Welt" ernannte, enthielt eine Falschbehauptung (das Erlanger zum Beispiel ist älter). Danach wurde es nicht besser. Unverdrossen die Kompetenzen von Bund und Ländern vermischend, forderte er, den Solidaritätszuschlag den Kulturhaushalten zuzuschlagen. Daraus sollten künftig auch Printmedien gefördert werden; als ob Zeitungen am finanziellen Gängelband des Staates ein demokratisches Ideal wären. Keiner der Vorschläge war juristisch umsetzbar.
Ohnehin ist kaum einer weniger dazu berufen, mehr Geld für die Bühnen zu fordern. Das Nationaltheater leistet sich, während bei Darstellern und Sängern gespart wird, fünf Intendanten. Dass gerade in Kosminskis Sparte ungewöhnlich aufwendige Bühnenbilder realisiert werden, mag noch künstlerischen Argumenten geschuldet sein. Anders verhält es sich, wenn – wie vor einigen Spielzeiten geschehen – eigens für eine Produktion und für einen Betrag, von dem ein Hartz-IV-Empfänger mehrere Monate leben muss, ein Ring angeschafft wird. Motto: Ein falscher König braucht wenigsten echten Schmuck. Selbst aus den vorderen Reihen war das edle Requisit, das dem Schauspieler nur gegen Quittung ausgehändigt und umgehend nach jeder Aufführung weggeschlossen wurde, nicht zu erkennen.
Betriebsklima im Mannheimer Ensemble lässt zu wünschen übrig
Weil Kosminski vor allem ins Abseits strahlt, gärt es im Ensemble. Das Haus ist unter ihm zum theatralen Himmelfahrtskommando geworden, gilt als Karrieren-Endlager. Wer hier arbeitete, kommt an den ersten Bühnen des Landes nicht mehr unter. Jenny König, die er gebetsmühlenartig als Gegenbeweis anführt, ist die berühmte Ausnahme, welche nicht die Regel entkräftet. Sie wechselte 2009 sofort nach ihrem zweijährigen Anfängerengagement an die Berliner Schaubühne und gehörte zu kurz dazu, um mit seinem Theater identifiziert zu werden. Neben der Aussichtslosigkeit drückt die Belastung durch die vergleichsweise vielen Neuproduktionen und das große Repertoire das Betriebsklima. Der hochtourige Leerlauf, den der ehrgeizige Intendant dem Ensemble für immer wieder neue Schlagzeilen und Auslastungsrekorde aufbürdet, fordert Tribut und manchmal auch die Gesundheit.



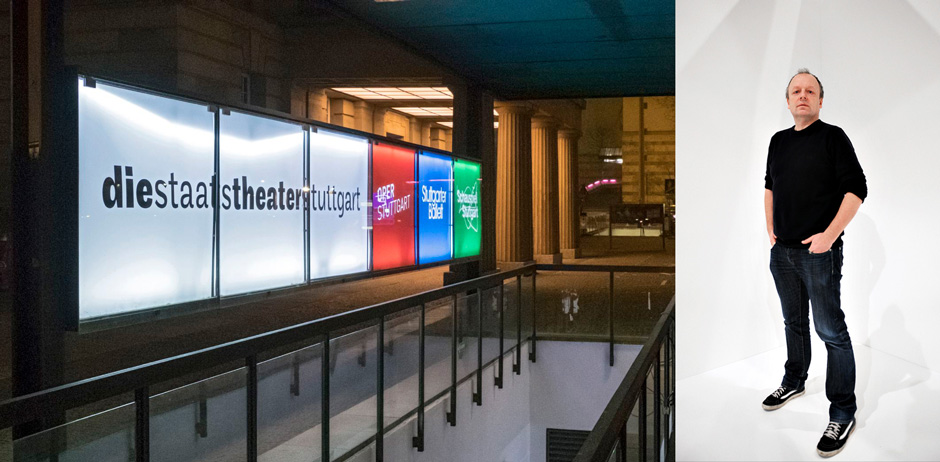














4 Kommentare verfügbar
-
Reply
.. und heute steht der Artikel "Kreativ mit der Zukunft spielen" von Roland Müller in der StZ. Haben die beiden Herren eigentlich über den gleichen Intendanten geschrieben? Oder gibt es zwei Personen mit dem Namen Kosminski?
Kommentare anzeigenMarlies Beitz
at