Der Schreiner Daniel Blake, nach einem Herzinfarkt von seiner Ärztin arbeitsunfähig geschrieben, wird von einer "Gesundheitsdienstleisterin" angerufen. Noch sind in diesem Film keine Bilder zu sehen, nur ein absurd anmutender Dialog ist zu hören. Eine maschinenhaft fragende Frau, die keinen Millimeter von ihrem abzuarbeitenden Formular abweicht, und ein Mann in zunehmender Verzweiflung, der sich und seine Situation in diesen Fragen nicht wiedererkennt. "Können Sie einen Hut aufsetzen?", will sie wissen. "Ja", sagt er, "aber es geht um mein Herz!" Es ist zum Lachen. Und es ist zum Heulen. Denn das ist ja kein missglücktes Gespräch unter Gleichberechtigten, sondern ein einseitiges Verhör, das existenzvernichtende Konsequenzen haben kann. Daniel Blake, ein Mann Ende fünfzig, wird nach diesem Telefonat für gesund und arbeitstauglich erklärt.
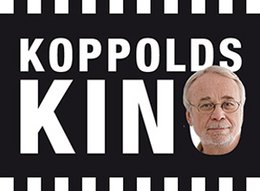
Und so findet sich dieser Witwer (Dave Johns), ein stämmiger Kahlkopf aus Newcastle, in einem Teufelskreis wieder. Auf Sozialhilfe hat er keinen Anspruch, Arbeitslosengeld dagegen werde, so wird ihm erklärt, nur an Gesunde ausgezahlt. Daniel will eine Nachprüfung beantragen und gerät in endlose telefonische Warteschleifen ("Drücken Sie die Taste eins ... Drücken Sie die Taste vier ..."); er soll ein Formular ausfüllen, das es angeblich nur online gibt, sitzt irritiert vor Bildschirmen, tippt nervös und zögerlich herum, bis ihm wieder ein Fehler gemeldet wird oder die Eingabezeit abgelaufen ist; er muss zu einer lächerlichen Fortbildung, in welcher der Seminarleiter zuerst auf die Diskrepanz zwischen den wenigen offenen Stellen und der Masse der Bewerber hinweist und dann fordert: "Sie müssen sich aus der Masse hervorheben!"
Der mittlerweile achtzigjährige Regisseur Ken Loach, der für diesen Film mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde, ist selber ein Arbeiterkind. Er hat mit einem Stipendium an der Eliteuniversität Oxford studiert, wurde aber nie zu einem Aufsteiger, der seine Wurzeln abstreift, sondern blieb seiner Herkunft, seinem Milieu, seiner Klasse treu. Das heißt in seinem Fall: er hat in Filmen wie "Kes" (1969), "Riff-Raff" (1991), "My name is Joe" (1998) oder "Looking for Eric" (2009) einen solidarischen Blick auf seine Welt geworfen und große Geschichten aus ihr erzählt. Geschichten voller Empathie, Humor und Gefühl – und fast immer gespeist aus einer klassenkämpferischen Wut über die Zustände, in die seine Protagonisten hineingezwungen sind.
Ken Loach kämpft für "seine" Arbeiterklasse
Die Helden in Ken-Loach-Filmen ergeben sich freilich nicht, jedenfalls nicht von vornherein. Sie haben ihren Stolz, ihre Würde, ihre eigene Kultur, sie leisten Widerstand, sie können dabei zunächst noch vertrauen auf den Beistand der Familie, der Freunde, der Nachbarn und der Kollegen, also auf eine selbstbewusste Arbeiterklasse. Doch spätestens seit Maggie Thatchers neoliberaler Kriegserklärung an die da unten ("So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht!") ist Ken Loach nicht nur zum Chronisten seiner Klasse geworden, sondern auch zu dem ihres Niedergangs. Doch resignieren kann und will er nicht: Wenn die arbeitslosen Arbeiter für ihr Schicksal selber verantwortlich gemacht werden, wenn der britische Boulevardjournalismus sie als Schmarotzer denunziert und TV-Comedys sie zum Auslachen freigeben, setzt Loach etwas dagegen. Zum Beispiel einen großartigen Film wie "Ich, Daniel Blake".
Der Regisseur zeigt sich hier auf der Höhe seiner Kunst. Wie schnell zum Beispiel aus seinen Figuren plastische Charaktere werden! Weil eben nicht nur wichtig ist, was sie sagen, sondern auch wie sie es sagen und unter welchen Umständen. Und wie präzise Loach und sein Drehbuchautor Paul Laverty ihre langen Recherchen für diesen Film verdichtet und in Form gebracht haben! Es ist eine Kunst, die freilich gar nicht als solche auffallen will, ganz selbstverständlich stellt sie sich in den Dienst des ökonomischen Erzählens und schafft dabei nicht nur eine große Spannung, sondern erreicht auch etwas, was solchen Milieu-Filmen oft nicht zugetraut wird: narrative Eleganz.

















1 Kommentar verfügbar
-
Reply
was nützen uns solche filme, wenn der politiker oder richter gegen den betroffenen entscheidet
Kommentare anzeigencource
at