Jerusalem nach dem Zweiten Weltkrieg, zur Zeit des britischen Mandats und kurz vor der Gründung des Staates Israel: Der junge Amos (Amir Tessler) ist mit seinen Eltern von einer Palästinenserfamilie eingeladen worden, er spielt im Garten der Villa mit der etwa gleichaltrigen Tochter des Hausherrn und erklärt ihr: "Es ist Platz für zwei Völker in diesem Land!" Der Junge wird sich als Erwachsener Amos Oz nennen, ein erfolgreicher Schriftsteller werden, sich zur israelischen Friedensbewegung bekennen und für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. In seinem autobiografischen Roman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis", erschienen 2002 und nun verfilmt von Natalie Portman, sieht Oz also schon als Junge eine Lösung des Palästinakonflikts, bevor dieser noch richtig entbrennt.
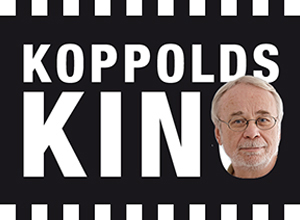
Aber auf diese sonnendurchflutete Sequenz legt sich ein Schatten. Amos lässt sich von dem Mädchen zu einer Mutprobe anspornen: Er klettert auf einen Baum, zerrt übermütig an einem Seil wie Tarzan an einer Liane, sodass schließlich ein Unglück passiert und ein kleines Kind verletzt wird. Nein, da ist keine Absicht zu unterstellen. Es handelt sich nur um die Fahrlässigkeit eines Jungen, der seine Taten noch nicht recht einzuschätzen weiß. Und dennoch wirft dies die Frage auf: Wie angemessen ist es, so einen Konflikt – also das Verhältnis zwischen Juden und Palästinensern – in dieser Weise auf die Kinderebene herunterzubrechen? Denn dieses Ereignis geht weit über eine Kindheitserinnerung hinaus: Es wird zum metaphorisch aufgeladenen Historienbild.
Dass der Film die Schuld am Konflikt, der gleich nach der Gründung Israels 1947 zum Krieg führt, eher bei den Palästinensern sieht, wird dann in knappen Szenen mehr suggeriert denn ausgemalt. Zwar vergisst dieses Drama nie seinen politisch-historischen Hintergrund. Letztlich erzählt es aber die Geschichte einer fantasiebegabten Mutter, die in Depressionen abgleitet, und ihres geliebten Sohnes Amos, der ihr nicht helfen kann. Und der Vater? Der ist ein erfolgloser Intellektueller, sehr spröde und nur eine Randfigur. Dass die Hauptfigur dann freilich nicht der Sohn Amos ist, sondern die Mutter Fania, liegt wohl auch daran, dass der Hollywoodstar Natalie Portman für diesen Film nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt hat, sondern auch noch die Hauptrolle übernimmt. Und das tut ihrem Film leider nicht gut.
Immerhin stets bemüht
Die in Israel geborene und in den USA aufgewachsene Portman hat sich lange Jahre mit dem Stoff beschäftigt, und es ist ihr sogar gelungen, ihre Adaption in hebräischer Sprache zu realisieren. Aber sie schafft es nicht, den Stoff auch in den Griff zu bekommen, ihn straff und und schlüssig zu inszenieren. Umständlich springt Portman in der Chronologie hin und her, fügt auch einen durch das heutige Jerusalem flanierenden alten Mann als Erzähler ein – ein weiteres Alter Ego von Amos Oz – und müht sich daran ab, Fanias Fantasien zu bebildern. Die erzählt ihrem Sohn mal märchenhafte Geschichten von Mönchen und Mädchen, mal von einem marodierenden Offizier in ihrer Heimat Polen, der betrunken in ein Bürgerhaus eindringt, auf Kronleuchter schießt und sich dann selber in den Kopf. Und manchmal träumt Fania auch sehnsüchtig von einem muskulösen israelischen Pionier und Kibbuzim, der so ganz anders aussieht als ihr eigener Mann.












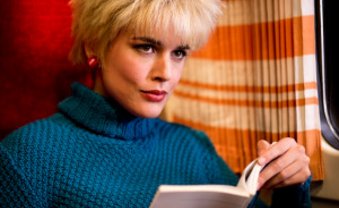




0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!