Eine Handkamera streift langsam, fast zögerlich durch die Räume einer menschenleeren Frankfurter Wohnung. Ein suchender, ein tastender Blick, der Zettel und Bilder an der Wand einfängt, herumliegende Kleider und Bücher, einen unaufgeräumten Schreibtisch, eine Dunkelkammer. Die Fotografin Abisag Tüllmann (1935–1996) hat hier gelebt. Die Filmaufnahmen sind drei Tage nach ihrem Tod entstanden. Gedreht wurden sie von Claudia von Alemann, einer guten Freundin, die nun in ihrem Filmessay "Die Frau mit der Kamera" an Tüllmann erinnert und diese Szenen an den Anfang setzt.
Die Fotografin war schwer krank, sie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. Aber in dieser Wohnung wurde keine Bilanz gezogen, nichts einsortiert für die Nachwelt, nichts aufgeräumt für eine Trauergemeinde. Hier sind vielmehr Spuren des Lebens zu sehen, hier wurde bis zuletzt gearbeitet. Und diese Insignien der klassischen Moderne, der Breuer-Stuhl, die Wagenfeld-Lampe oder der Ulmer Hocker, sie stehen hier nicht repräsentativ herum, sie waren alle im Gebrauch. Tüllmann hat an der (Bilder-)Geschichte der Bundesrepublik mitgeschrieben, aber um sich selber hat sie wenig Aufhebens gemacht. So wenig, dass Alemanns Film zu einem Porträt wird, in dem die Porträtierte beinahe verschwindet, besser: ganz in ihrer Arbeit aufgeht.
An der Ulmer Hochschule für Gestaltung hat Alemann die Fotografin kennengelernt und war seit dieser Zeit mit ihr befreundet. In ihrem Film, in dem die Regisseurin aus dem Off erzählt, versucht sie in der Zeit weiter zurückzugehen, in die Kindheit und Jugendjahre von Abisag Tüllmann, deren Vater Zwangsarbeit leisten musste und schon 1945 starb, deren Mutter von den Nazis als Halbjüdin gebrandmarkt wurde, sodass sie sich mit ihrer Tochter in den letzten Kriegsjahren verstecken musste. Aber sehr viele Details aus diesen frühen Jahren kann Alemann nicht finden. Und auch nicht sehr viel über das Leben einer jungen Frau, die ein Tischlerpraktikum absolvierte, ein Innenarchitekturstudium abbrach, in den späten Fünfzigerjahren als Fotografin für die Frankfurter Zeitungen arbeitete und später auch für den "Spiegel" oder die "Zeit".
Vom Tischlerpraktikum zu "Spiegel" und "Zeit"
Einen Brief der jungen Abisag Tüllmann allerdings entdeckt die Regisseurin, in dem ein nur scheinbar privater und immer noch aktueller Konflikt angesprochen wird, der damals noch viel schwerer zu lösen war. Wenn sie sich zwischen ihrer Arbeit und einem Kind entscheiden müsste, schreibt sie da, würde sie sich wohl für ihre Arbeit entscheiden. Ganz lapidar erzählt Alemann dann von einer Beziehung der Fotografin und von einer Fehlgeburt, die "durch das Heben schwerer Kisten" verursacht wurde. Nein, nichts weiter. Ob sich Tüllmann mehr oder weniger bewusst gegen das Kind entschieden hat, bleibt offen. Dass sich ihre Freundin Claudia von Alemann aber bewusst dafür entschieden hat, diese Problematik in ihrem Film nicht zu verschweigen, muss man ihr hoch anrechnen.




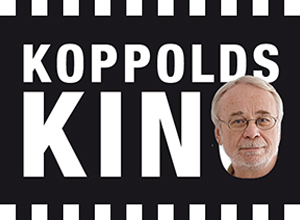












2 Kommentare verfügbar
-
Reply
Also Frau Bosch - das nervt - der Film läuft die ganze Woche im Atelier am Bollwerk. Gehen sie hin, sonst ist er in einer Woche wieder verschwunden.
Kommentare anzeigenMac
at