Ein türkisches Dorf am Schwarzen Meer. Der Unterricht ist aus, die großen Ferien sind da. Noch in ihren Uniformen stürzen sich fünf Schwestern mit ihren Mitschülern in den Sommer, laufen an die Küste, tollen herum, wagen sich ins Wasser, steigen den Jungen auf die Schultern, schubsen sich. Dann laufen sie durch eine Obstwiese, klauen ein paar Äpfel und flüchten lachend vor dem flintenbewaffneten Bauern. Als sie daheim ankommen, in einem großen und von viel Grün umgebenen Haus, ist die Nachricht von ihrem Tun schon da. "Ihr habt euch an den Jungs gerieben!", so lautet die Anklage der Großmutter, die seit dem Tod der Eltern für die Erziehung verantwortlich ist. Einzeln werden die Mädchen in ein Zimmer zur Züchtigung gezerrt, aber das ist noch nicht genug. "Wenn sie befleckt sind, bist du schuld!", wirft der wütende Onkel der Mädchen seiner Mutter vor. Er hat nun das Sagen, und so werden die Teenager alle in eine Klinik gekarrt zum Jungfrauentest.
"Es ging uns gut, dann ging alles den Bach runter", sagt Lale (Güneş Nezihe Şensoy), die jüngste der Schwestern, die diese Geschichte gerade erlebt, sich mit solch kommentierenden Sätzen aus dem Off aber auch als rückblickende Erzählerin erweist. Der Hymentest ist übrigens in allen Fällen ohne Befund, trotzdem wird die Welt für die vorher so ausgelassene Fünferbande nun immer enger. Wenn die Mädchen mal ins Dorf dürfen, dann nur verhüllt, ansonsten stehen sie unter Hausarrest. Aber sie ordnen sich noch nicht unter, klettern die Dachrinne hinab und über die Grundstücksmauern, fahren zu einem Fußballmatch von Trabzonspor, schreien euphorisch im Stadion herum. Die Bilder aus dem Fanblock werden im TV übertragen und sind auch im Dorf zu sehen, da zeigt sich zu Hause nun doch ein bisschen antennenausstöpselnde Frauensolidarität. Oder ist es wieder nur die Angst vor den Sanktionen einer patriarchalisch dominierten Gesellschaft?
Jeder Ausbruch und jeder Verstoß der rebellischen Mädchen gegen ein Verbot wird bestraft durch eine weitere Verengung des Raumes. Wortlos-lapidare Szenen von der Vergitterung der Fenster, von der Verschweißung der Fluchtwege. Auch mit der Liberalität innerhalb des Hauses ist es nun vorbei. "Jetzt trugen wir formlose, kackbraune Kleider", erzählt Lale, die mit ihren Schwestern vorher noch leicht geschürzt herumalberte. Gerade weil die Mädchen in diesem elternlosen Haus freier aufwuchsen, als es in dieser Gesellschaft sonst erlaubt ist, empfinden sie ihre neue Situation als besondere Schikane. Jetzt heißt es auch, unter Anleitung von Nachbarinnen, kochen und backen zu lernen. "Das Haus", so die rebellische Lale, "wurde zu einer Fabrik für Ehefrauen." Und so tauchen nun die vom Onkel und der Großmutter ausgesuchten Männer mit ihrer jeweiligen Verwandtschaft zu Hochzeitsverhandlungen auf. Und die als Ehefrauen ausersehenen Schwestern müssen ihnen stumm Tee servieren.
"Mustang" ist das Spielfilmdebüt von Deniz Gamze Ergüven, einer am Schwarzen Meer aufgewachsenen und in Frankreich lebenden Regisseurin. Ihr Werk wurde für den Oscar in der Sparte "bester nicht englischsprachiger Film" nominiert, und die Kinovorführungen fallen nun auch in eine Zeit hinein, in der die Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan im Fokus der Weltöffentlichkeit steht. Ist dies ein Film für oder gegen das Land, in dem er gedreht wurde? Ist diese Geschichte voreingenommen? Blickt sie mit westlichen Augen auf eine andere Kultur und bestätigt sich dabei die eigenen Vorurteile? In Internetforen werden solche Fragen diskutiert, und es geht dabei auch um Details. Ob die Schauspielerinnen für Bewohner der Schwarzmeerküste zu großstädtisch wirken; ob es dort tatsächlich noch den Brauch gibt, nach der Hochzeitsnacht ein blutiges Laken zu präsentieren; ob in der Türkei überhaupt noch Jungfrauentests gemacht würden. Ja, schreibt dazu eine Ärztin.
Diesem Film droht also die Gefahr, als einseitiges politisches Statement gegen die Türkei verstanden zu werden. Doch sein Thema ist viel universeller: Es geht um gesellschaftliche Repression, um die Beschneidung von Freiheit, um männlichen Machterhalt. Dabei spielt in "Mustang" der Islam kaum eine Rolle, die Unterdrückung kommt, zynisch gesagt, auch ohne Religion aus. Was die Regisseurin diesem patriarchalischen System entgegenzusetzen hat, sind weniger verbal ausformulierte Argumente denn sinnlich-poetische und intime Bilder von Ungezwungenheit, Selbstbestimmung, Aufruhr und Freiheit, die in ihrem atmosphärischen Schweben manchmal an Sofia Coppolas Schwesternfilm "Virgin Suicides" erinnern. Zum Beispiel, wenn sich die fünf Mädchen immer wieder zu einer organischen Einheit zusammenknäueln, sodass Hände, Arme, Beine und Füße nicht mehr individuell zuzuordnen sind. Und immer wieder lassen sie stolz ihre langen Haare im Wind flattern.




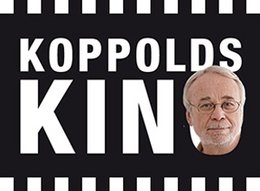











0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!