Die Gründungsgeschichte der Bachakademie ist mit Kellers Familie verwoben, genauer: mit seinem Vater. "Mit Hermann Keller hatte die Technische Hochschule Stuttgart 1919 einen Lehrbeauftragten für Musikgeschichte gewonnen", heißt es in einer Untersuchung zur NS-Geschichte der heutigen Universität, "der sich bald zu einem bedeutenden Musikwissenschaftler, Pianisten, Organisten und Komponisten entwickeln sollte." Hermann Keller war damals 33 Jahre alt.
Er hatte zunächst Architekt werden wollen wie sein Vater, nahm dann aber Privatunterricht bei dem Komponisten Max Reger (1873 bis 1916), der ihm riet, Musiker zu werden. Für Reger war Bach "Anfang und Ende aller Musik". Hermann Keller folgte dessen Spuren. Er wurde Organist an der Stuttgarter Markuskirche, Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule, Professor und Leiter der Abteilung Kirchen- und Schulmusik an der Musikhochschule.
1935 wurde Hermann Keller Vorsitzender des württembergischen Bachvereins und Vorstandsmitglied der Internationalen Bach-Gesellschaft, musste jedoch seine Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule und an der Musikhochschule bald danach aufgeben. "Aus politischen Gründen schied er 1936 aus", bezeugt 1952 der Germanist Fritz Martini, offenbar im Zusammenhang "mit dem früheren Engagement seiner Söhne in einer bündischen bzw. kommunistischen Jugendgruppe", wie es in der Publikation der Uni heißt.
"Das war die DJ", sagt Andreas Keller wie aus der Pistole geschossen. Drei der vier Söhne seines Vaters aus erster Ehe waren in der Deutschen Jungenschaft aktiv, einer unabhängigen Gruppe der Jugendbewegung, 1929 gegründet von dem Stuttgarter Eberhard Koebel, der 1932 in die KPD eintrat. "Die DJ wurde 1933 sofort verboten", erklärt Keller, die drei Söhne seines Vaters alle in der Gestapo-Zentrale im heutigen Hotel Silber verhört.
Klassikexperte und Computerpionier
In der Familie war dies jedoch in der Nachkriegszeit kein Thema. "Es wurde über alles Mögliche geredet und auch heftig gestritten", sagt Andreas Keller, "aber darüber nicht." Als er auf die Welt kam, war sein Vater Hermann schon fast 60 Jahre alt. Nach dem Krieg war Keller senior sieben Jahre lang Direktor der Stuttgarter Musikhochschule. Auch der Junior studierte zunächst Musik und wollte Cellist werden, musste dann jedoch einsehen, dass er es nicht zu einem erstklassigen Profimusiker bringen würde.
Daher ging er auf Empfehlung seines Vaters zum Musikverlag Bärenreiter nach Kassel. Ein mittelständischer, inhabergeführter Betrieb, aber, wie Keller sagt, "am Puls der Zeit". Er habe dort alles gelernt, was er später brauchen konnte: "Ich hatte viele Freiheiten und eine hervorragende Schulung in Veranstaltungstechnik, die drei Jahre bei Bärenreiter waren meine Lehrjahre", resümiert er. Unter anderem belegte er damals, um 1970, schon EDV-Kurse. "Wir waren dann in Stuttgart die ersten, die Computer eingeführt haben."




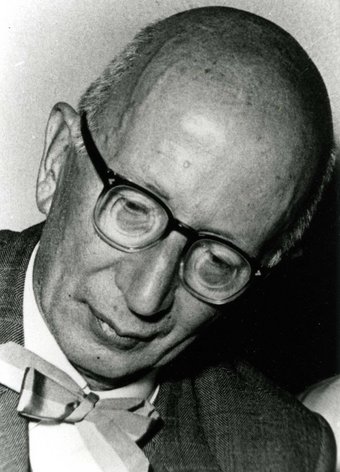

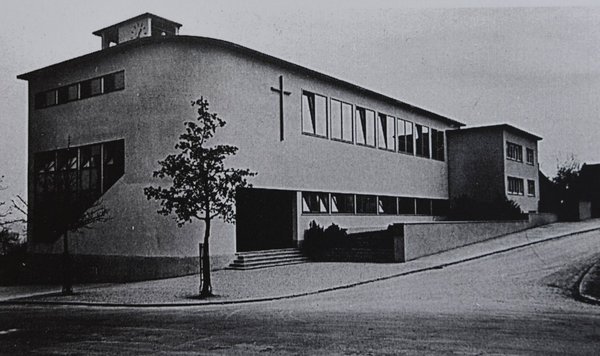




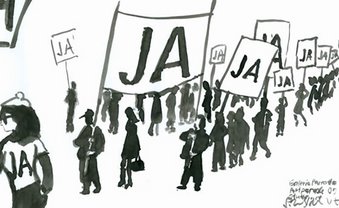




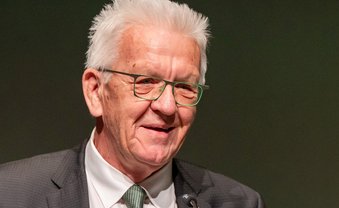



0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!