Normalerweise deutet es auf eine erhabene Position hin, von einem hohen Ross herabschauen zu können. Ein unbetiteltes Werk der Polizei Freiburg bricht ironisch mit diesem Topos: Zu sehen ist eine uniformierte Reiterin, die als Verkörperung der Staatsgewalt doch eigentlich zur Souveränität verpflichtet wäre. Aber die arme Frau scheint um Fassung zu ringen, was nur allzu verständlich ist. Schließlich wächst dort, wo ihr rechter Fuß sein sollte, ein weiteres Bein. Und das wäre geeignet, selbst der erfahrensten Kriminalhauptkommissarin den Boden unter den Füßen wegzuziehen – wäre da nicht die Standfestigkeit eines Pferdes, das Polizeistiefel trägt. Und so hält sich unsere Heldin irgendwie im Sattel, auch wenn die Ordnungsmacht in Anbetracht derartig surrealer Zustände ein wenig überfordert wirkt.
Ist das hier die Realität? Wo auch die wahre Wirklichkeit zunehmend fiebertraumhafte Züge annimmt, drängt sich diese Frage bei der Zeitungslektüre nahezu täglich auf. Im Schweizerischen Lausanne etwa fuhr vergangene Woche ein 56-Jähriger mit seinem BMW in eine Pro-Palästina-Demo und gab an, er habe im Affekt gehandelt – weil er die Menschenmenge fälschlicherweise für einen Klima-Protest gehalten habe. Und gefühlt schafft es diese tückische Kombination zuletzt immer öfter in die Schlagzeilen: todernste Ereignisse, denen durch absurde Dummheiten ein lächerliches Element anhaftet.
In diesen seltsamen Zeiten soll die Polizei für Ordnung sorgen, doch unter jeder Uniform steckt ein Mensch, der irgendwie weitermachen muss. Jedenfalls in der wirklichen Welt. Bei der Reiterin auf dem gestiefelten Pferd handelt es sich um das Fantasieprodukt einer Künstlichen Intelligenz – dass sie mit ihren drei skeptisch gelupften Augenbrauen ein perfektes Sinnbild der gegenwärtigen Verhältnisse darstellt, ist ein glücklicher Zufall. Wie die Freiburger Polizei auf Facebook mitteilt, wollte sie eigentlich ein Symbolbild ihrer Reiterstaffel generieren, "in hochwertiger Aufmachung, vor schöner Kulisse, sympathisch und bürgernah." Vor allem aber: "EIN BILD, DAS SICH EINPRÄGT – Nun ja, was sollen wir sagen, Letzteres ist uns in jedem Fall gelungen ....... Was sagt Ihr denn zu unserem ersten Gehversuch?"







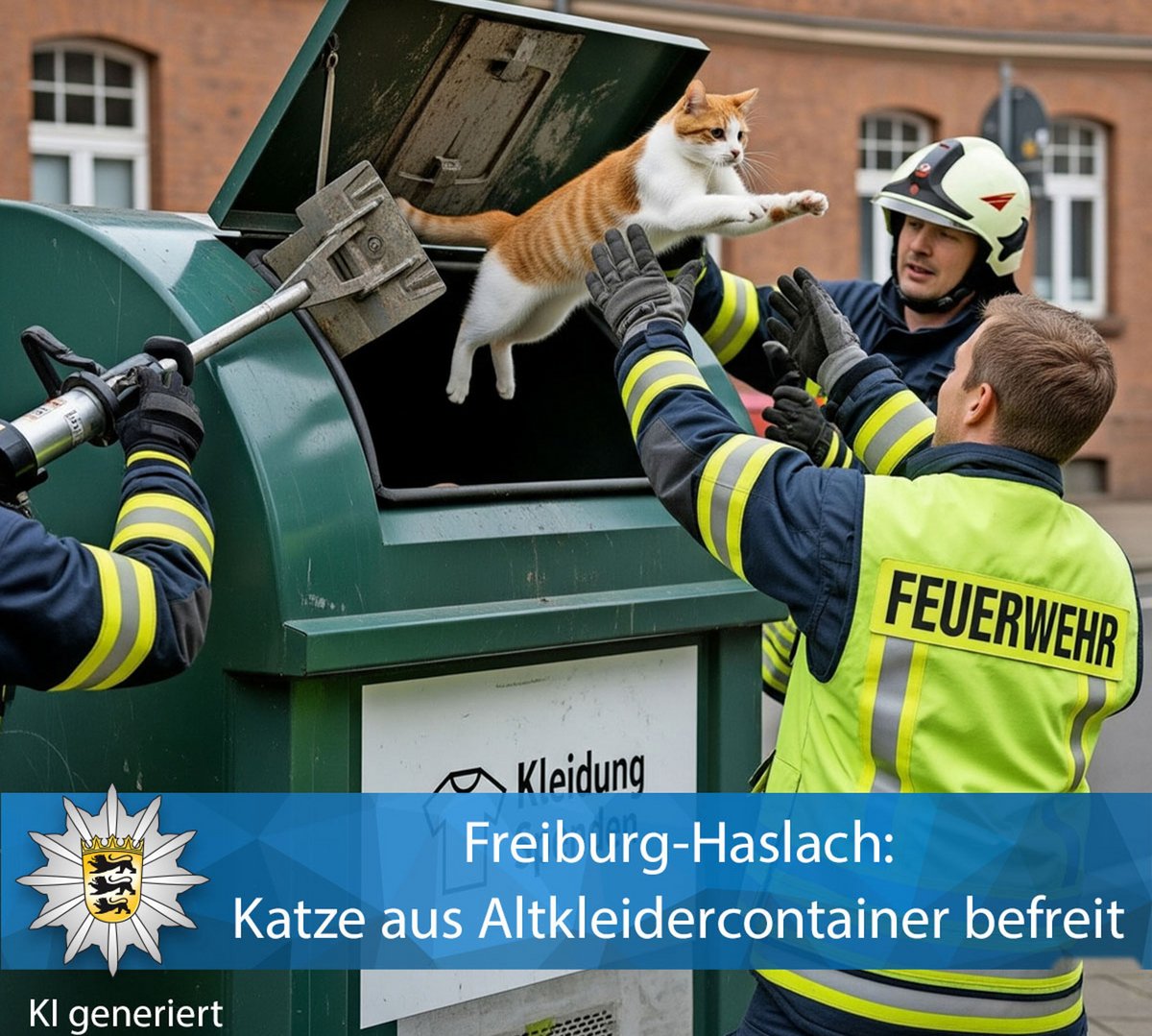




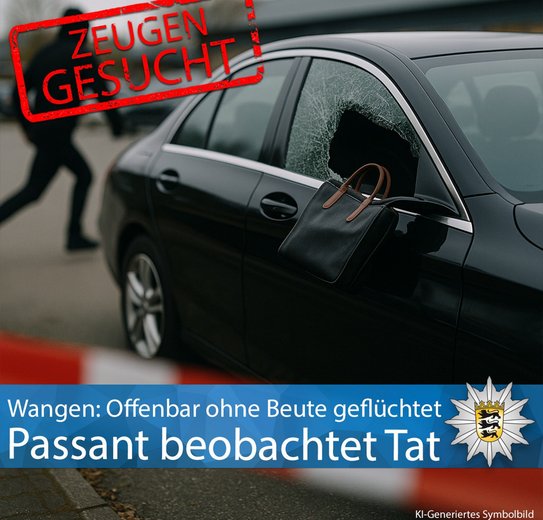











0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!