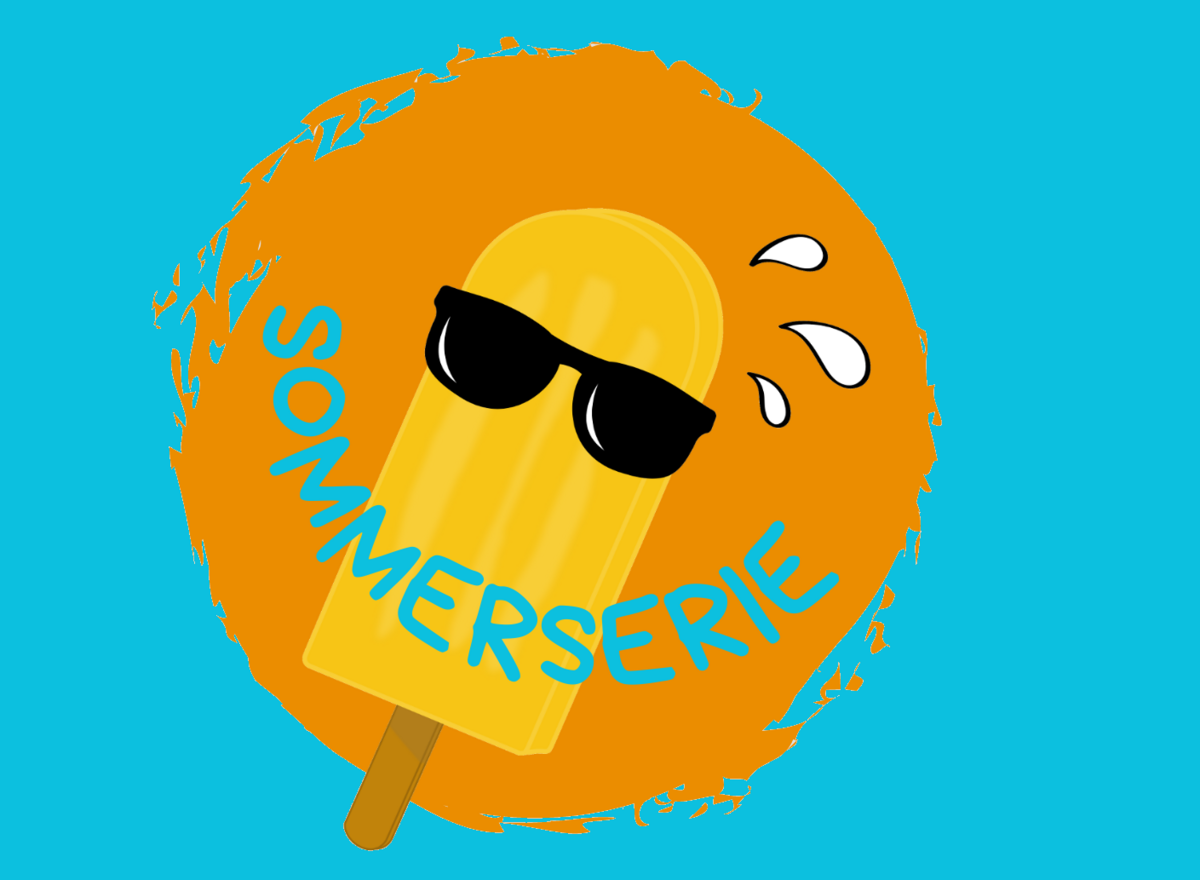
Sommergedanken
"Was für ein schönes Angebot!", hieß es vielfach, als wir unsere Autor:innen für unsere Sommerserie anfragten. Ob sie nicht ein Thema hätten, über das sie schon immer mal schreiben wollten? Selbstverständlich. Angesichts konkfliktvoller Zeiten wird nicht alles leicht und luftig werden. Rassismus und Systemkritik kommen vor, Armut und Lachen, aber auch Sylt und sogar das Videospiel Counter-Strike. Zum Auftakt haben wir Don Eulogio, eine echte Type in Mexiko-Stadt, vorgestellt. Dann ließen wir uns von einer geheimnisvollen Postkarte entführen. Folge drei begleitet eine Frau, die Inklusion tagtäglich lebt. (red)















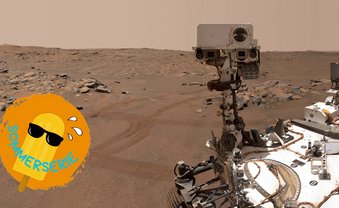





0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!