Der Rollenwechsel, mit dem auch ein neues Image verbunden ist, macht entsprechend Laune, befreit von der täglichen Angst, hinter jeder Hecke einen Schützen vermuten zu müssen. Es sei "ausgesprochen wohltuend", bestätigt die frühere baden-württembergische Kultusministerin, sich in diesen Kreisen zu bewegen, in denen Tonart und Umgang anders seien als in der Politik. Aber zur Heiligsprechung sei es noch zu früh.
Diese Aufgabe übernimmt Martin Brudermüller, der Aufsichtsratschef der Mercedes-Benz Group – in seiner Würdigung von Edzard Reuter. Ein "Kämpfer für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit" sei er gewesen, ein "Mensch von außergewöhnlicher Tiefe, Weitsicht und Integrität", eine der "prägendsten Persönlichkeiten unserer Unternehmensgeschichte". Zu Lebzeiten hätte der "engagierte Philanthrop" Reuter gefragt, ob's vielleicht auch ein paar Nummern kleiner ginge. Zumal das Verhältnis Daimler–Reuter eine Hochzeit im Himmel wohl nicht zugelassen hätte. Brudermüller ist dann auch schnell wieder weg.
Mutig in Eberswalde
Susanne Eisenmann bleibt am Boden. Sie ehrt die Initiative "meet2respect", die Imame und Rabbiner in Schulen schickt, und einen Bäcker aus Eberswalde: Björn Wiese, 52, ein Kerl wie ein Baum, bildet Syrer, Afghanen und Pakistani aus, hilft ihnen bei der Wohnungssuche und beim Kampf mit der Bürokratie. 20 Prozent seiner 40-köpfigen Belegschaft haben migrantischen Hintergrund.
Das ist mutig, zumal in einer Stadt, die ihre eigene Geschichte mit rechtsextremer Gewalt hat. In der Nacht des 24. November 1990 war es, als 50 Skinheads den 28-jährigen Angolaner Amadeu Antonio zu Tode trampelten. Sie nannten es "Neger klatschen". Der erste politisch motivierte Mord nach der Wiedervereinigung geschah vor den Augen der Polizei, die nicht eingriff. Heute ist die AfD die stärkste Fraktion im Rathaus, bei den Bundestagswahlen stimmten 33 Prozent für die rassistische Truppe um Alice Weidel und Björn Höcke.
Bäckermeister Wiese kann noch Orte aufzählen, die über der 40er-Marke liegen, und dennoch oder gerade deshalb macht er weiter. Er habe als Kind der DDR auf Rügen gesehen, wie die Schiffe nach Schweden abgelegt haben, sagt er, und sich jedesmal "nach Freiheit gesehnt". Und die sei nun mal unteilbar.







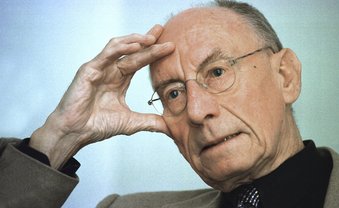







0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!