Das ist Blödsinn. Denn selbstverständlich gendert sogar der Kanzleiverbund, dem der geistige Vater des einschlägigen Aufrufs, der Heidelberger Rechtsanwalt Klaus Hekking, angehört. Zum Beispiel wenn er seine "lieben Mandantinnen und Mandanten" informiert oder "zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit dem Interessenschwerpunkt allgemeines Zivilrecht" sucht. Auch Manuel Hagel, der nicht eben an der Spitze gesellschaftlicher Modernisierung einherreitet, verwendet die Paarform, wenn er in einem Saal die Zuhörenden begrüßt, wenn er die Trecker-Proteste unterstützt, weil "unsere Bäuerinnen und Bauern eine großartige Arbeit leisten", wenn er die "41 Kolleginnen und Kollegen" in seiner Landtagsfraktion rühmt. Sogar Studierende statt Studenten hat sich eingeschlichen in die Sprache der Schwarzen.
Als gäbe es keine Unterschiede
Der Duden übersetzt Gender mit Geschlecht und erklärt das Lehnwort aus dem Englischen mit "Geschlechtsidentität des Menschen als soziale Kategorie, zum Beispiel im Hinblick auf seine Selbstwahrnehmung, sein Selbstwertgefühl oder sein Rollenverhalten". Erwähnt werden im allgemeinen Sprachgebrauch längst etablierte Kombinationen wie Gender-Mainstreaming ("Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Lebensbedingungen und Interessen") oder Gender-Pay-Gap für die nach wie vor bestehenden Entlohnungsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Desgleichen die Genderforschung, in der es "unter anderem um Fragen sozialer Ungleichheit aus einer Geschlechterperspektive" geht, oder die Gendermedizin, die "geschlechtersensibel beziehungsweise geschlechtsspezifisch vorgeht, mit dem Ziel, eine optimale medizinische Versorgung aller Geschlechter sicherzustellen".
Spätestens bei den letzten beiden Begriffen könnte sich der damalige Junge-Unions-Landesvize Hagel an den Parteitag 2015 in Rust erinnern, bei dem die Tübinger Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz (CDU) einen heftigen Auftritt hinlegte. Wie mehrere JU-Verbände bundesweit hatte dort auch der baden-württembergische gefordert, Genderforschung nicht mehr zu finanzieren, weil, wie es im vielbejubelten Antrag hieß, sie "nur einer Ideologie dient – schließlich leisten wir uns ja auch keine Lehrstühle für Astrologie und Alchimie". Widmann-Mauz hielt vehement dagegen, unter anderem mit Hinweisen auf Geschlechtsunterschieden in Medizin und Diagnostik, etwa bei einem Herzinfarkt. Vorsichtshalber verzichtete das Parteitagspräsidium auf eine Abstimmung. Die AfD schrieb dann den Totalstopp "staatlicher Ausgaben für pseudowissenschaftliche 'Gender Studies'" 2016 in ihr Grundsatzprogramm.
Lieber beleidigen als respektieren
Hagel, der heutige Landes- und Fraktionschef der Schwarzen im Südwesten, wird die Kontroverse von damals kaum vergessen haben. Heute, um sieben Jahre gereift, könnte er wenigstens feinsäuberlich trennen zwischen notwendigem, inzwischen selbstverständlich gewordenem Gendern und dem Kampfbegriff der Rechten. Das will er aber nicht. Zu verlockend ist das Bestreben, in dieser politisch-kulturellen Fehde billige Punkte zu machen. Sprache sei kein Instrument der Bevormundung oder der Umerziehung, sagt Hagel im vergangenen Sommer im SWR, und dass "gesellschaftliche Missstände durch eine konstruierte Sprache nicht zu lösen sind". Aber Sprache kann darauf aufmerksam machen. Außerdem ist es schlicht höflich, sinnvoll und aus gutem Grund sachlich geboten, beispielsweise Vokabeln wie Zigeuner oder das N-Wort aus dem Sprachschatz zu streichen.
Seltsam nehmen sich auch die Hinweise von CDU und FDP auf Lesbar- und Verständlichkeit aus. Und das in Zeiten, da Denglisch und Englisch sich vielfach eingenistet haben in die deutsche Alltagskommunikation. Für Handy, Hashtag und The Länd gelten offenbar andere Maßstäbe als für männlich, weiblich und divers oder für den Nachvollzug in Wort und Schrift der nun mal beschlossenen Rechtslage. "Denn", so erinnert die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, "seit Ende 2018 haben inter* Menschen in Deutschland die Möglichkeit, beim Eintrag ins Personenstandsregister außer den Geschlechtern 'männlich' und 'weiblich' die Option 'divers' zu wählen, die sogenannte 'Dritte Option', nachdem der Erste Senat des Bundesfassungsgerichts im Oktober 2017 entschied, dass jenseits des binären Geschlechtermodells auch ein positiver Eintrag möglich sein muss, und damit der Beschwerde einer inter* Person stattgegeben hat." Im landläufigen Sinne nicht christlich gedacht ist es übrigens, gerade Letzteren, die vielfach erhebliche und nicht selbstverschuldete Probleme haben im Leben, dieses noch zusätzlich schwerzumachen durch die Dämonisierung von Stern, Unterstrich etc.
Mitgemeintsein ist den Kerlen zu wenig
Zahlreiche Studien, Analysen und Bücher befassen sich mit dieser Kontroverse. Luise Pusch, die feministische Sprachwissenschaftlerin, ist seit wenigen Tagen 80 Jahre alt und ihr 150.000-mal verkauftes Standardwerk "Das Deutsche als Männersprache: Diagnose und Therapievorschläge" vor 40 Jahren erschienen. Der Ruf auf einen Lehrstuhl blieb ihr in den Siebziger Jahren auch deshalb verwehrt, weil sie die so beliebte Argumentation "Frauen sind doch immer mitgemeint" als unseriöse Ausrede entlarvt hatte: Anstelle des generischen Maskulinums ("Liebe Kollegen!"), das zum Beispiel Winfried Kretschmann bis heute jeder geschlechtersensiblen Formulierung vorzieht, könne ja ebenso gut das generische Femininum ("Liebe Kolleginnen!) verwendet werden, als kollektive Bezeichnung für alle Geschlechter.





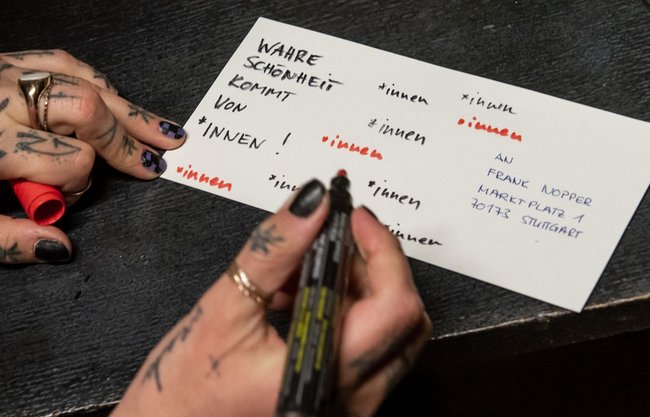









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!