Einmal täglich hat er bisher Tee ohne Zucker bekommen, in einem Joghurtbecher. 15 Kwacha, sieben Tage die Woche. Sonntags immerhin nur den halben Tag. Nur an Weihnachten hatte er einen freien Tag. Alles, was Stephen besitzt, ist ein zerrissenes Hemd und eine kurze Hose. Im "compound" schläft er bei einem Onkel auf dem Boden.
Herr Mumonalyima hat auch eine Haushaltshilfe anzubieten. 20 Kwacha monatlich. "Auch die brauchen Sie nicht zu übernehmen", meint er. Einen Tag nach unserem Einzug taucht eine ältere Frau auf. Wir sitzen im Garten beim Frühstück. Sie nimmt einen Besen und kehrt die Küche. Dann kehrt sie das Wohnzimmer. Sagt kein Wort. Blickt uns nicht mal an. Auch nicht, als wir uns vorstellen, nach ihrem Namen fragen, versuchen, ihr die Hand zu geben. Sie räumt wortlos das Geschirr ab, wäscht ab. Am nächsten Morgen dasselbe. Nein, einen solchen Menschen um uns halten wir nicht aus. Wir verabschieden sie mit einem Monatsgehalt. Und schlechtem Gewissen.
Wir lernen, dass Hauspersonal mit Vorliebe von neureichen Schwarzen mit "Iwe" angeredet wird, frei übersetzt "He Du". Auch Stephen, der auf sein Schicksal wartete, als wir das Haus bezogen. Wir wollen gute Menschen sein. Mit dem Gehalt eines weißen "Experten". Stephen bekommt nun das doppelte Gehalt. 30 Kwacha, fast 60 Mark. Für Frühstück und Mittagessen holt er sich aus der Küche, was er braucht.
"That boy will go mad", ruft Bianca, unsere Nachbarin, über den Zaun. Durchdrehen wird er, den Verstand verlieren. "Wir kennen diese Leute", meint sie nach 30 Jahren Afrika. Bianca und Giorgio kommen aus ärmlichsten Verhältnissen in Norditalien. Sie sind, als die Gastarbeiter nach Deutschland migrierten, der Armut erst nach Südafrika, dann nach Sambia entflohen, wo man zu Beginn der Unabhängigkeit Automechaniker brauchte. Sie eröffneten eine Kfz-Werkstatt. Für weiße und indische Geschäftsleute und für sambische Politiker. Für die "uppa mwamba", wie die "Oben" im Umgangsenglisch der Schwarzen genannt werden. "Güte nutzen sie aus", sagt Bianca über die "Unten". Aus lauter Güte nennt Bianca ihren Koch uns gegenüber "the boy". Edward, der Koch, ist Mitte 50. Er hat bereits erwachsene Kinder und Enkel.
Wir fragen den schwarzen Schriftsteller Chifunyse. Stephens bisheriges Gehalt ist unmoralisch, meinen wir. "Das mag sein, aber es ist normal hier", entgegnet er. "Er wird vom jetzigen nichts haben, weil die gesamte Großfamilie aus dem Dorf sich ihren Anteil holen wird. Das ist afrikanische Tradition. Wenn einer verdient, verdient er für alle." – "Sollen wir ihn deshalb ausbeuten?" – "Nein, aber investiert, was er nicht braucht, in seine Zukunft."
Der Schriftsteller Chifunyise ist ein selbstbewusster, radikaler Afrikaner aus Simbabwe. Er lebt in Sambia im Exil. Doch was er uns empfiehlt, ist wie ein Symbol für schwarz-weiße Beziehungen: der Konflikt europäischer Wertvorstellungen gegen afrikanische. Wir denken individuell, sind um Stephens Zukunft bemüht, weil wir eines Tages das Land wieder verlassen werden. Er kommt vom Dorf, wo alle für einen, aber, wenn es einer zu etwas bringt, einer eben auch für alle da ist. Wir entscheiden uns für die westlichen Wertvorstellungen. Legen für Stephen ein Bankkonto an, auf das ein Teil des in Abständen vertraglich steigenden Lohnes einbezahlt wird, wir fördern die Anschaffung seines Hausstandes – Kochgeschirr, Matratze, Bett, später ein Fahrrad. Schon mischen wir uns, gutmeinend natürlich, in afrikanische Kultur ein. Die persönliche "Entwicklungshilfe".
Stephen mit seinen 16 Jahren ist einer aus dem Heer der "school leavers", der Jugendlichen, die an einer auch 15 Jahre nach der Unabhängigkeit noch kolonial bestimmten Schule gescheitert sind. An der Unterrichtssprache Englisch, die zur täglichen Tortur wird, weil sie kein Afrikaner in seiner sozialen Umgebung spricht; am Geschichtsunterricht, in dem die englischen und schottischen Königshäuser abgehandelt werden, nicht aber die des vor-kolonialen Sambia oder Simbabwe. Und in der geprügelt und gebrüllt wird.
Stephen ist mit knapp 15 erst der Schule und wenige Wochen darauf der Armut des Dorfes davongelaufen in der Hoffnung, in der Stadt sein kleines Glück zu machen. Jetzt hat er es gemacht. Das spricht sich wie ein Lauffeuer im Dorf unter den Verwandten herum. Onkel und Neffen, Großvater und Großmutter kommen, seinen neuen Reichtum zu bestaunen. Sein eisernes Bettgestell und die bezogene Matratze, sein von ihm sauber gestrichenes Häuschen im Garten, seine ersten Schuhe, sein Holzkohleofen, sein Geschirr. Blitzblank.
Sie kommen auch, um zu hören, ob die "Madam" oder der "Bwana" nicht das eine oder andere zu entbehren hätten. Haben sie. Die wöchentlichen Berge von Zeitungen und Zeitschriften zum Beispiel, deren Fotos im Dorf viele lange Abende verkürzen werden und die sich anschließend trefflich mit Tabak rollen lassen und als Toilettenpapier dienen. Die in weiser Voraussicht mitgebrachten und noch tadellosen, aber zu engen oder aus der Mode gekommenen Kleider.
Afrika wird uns zum ständigen Konflikt. Die Begeisterung und Dankbarkeit des gesamten Verwandtschaftsclans erstickt die eigene Scham, für die Armen den gütigen St. Martin zu spielen mit unseren Altkleidern. Hätten wir sie wegwerfen sollen in Europa? Habe ich nicht selbst in schwäbischer Tradition den Konfirmationsanzug so oft umnähen lassen, bis das vorsorglich Eingenähte nichts mehr hergab? Jetzt passt er dem hageren alten Mann. Ein wenig Realsatire. Damit wird er nun am Sonntag in die Kirche gehen. Soll Stephens Großmutter in den verdammt kalten Nächten des sambischen Winters frieren, statt sich in die Pullover der "Madam" zu wickeln?
Der Elefant auf dem fliegenden Drachen
Lusaka, No. 19 Chindo Road. Schnelles Klopfen an unserem Gartentor. Gefolgt vom Schrillen einer Fahrradklingel. Ein winzig kleiner Afrikaner mit einer großen Umhängetasche auf einem geradezu riesig erscheinenden schwarzen Fahrrad wartet in respektvollem Abstand vor dem Gittertor. Er unterhält sich auf Zuruf. "I am your postman, Sir." – "Oh, wundervoll. Kommen Sie näher." – "Oh nein, Sir. Die Hunde." – "Wir haben keine Hunde. Nur eine Katze." Erleichtert kommt er näher. Sein Name ist Mr. Njovu. Sehr einfach.
Für ihn ist es umgekehrt noch einfacher. Wir sind und bleiben für ihn "Sir" und "Madam". Immer verbunden mit einem "Yes please". Der kleine Mann auf dem riesigen Fahrrad klopft fast täglich mit dem Stein ans Tor, auch wenn keine Post da ist. "No mail, Sir. I'm sorry. Maybe tomorrow."
Unsere einheimischen Sprachkenntnisse in Nyanja machen langsame Fortschritte. Njovu heißt Elefant. "Mr. Elephant" also.
Das schwarze gewaltige Fahrrad stammt aus China. "Flying dragon" haben sie in leuchtend roter Schrift drauf geschrieben. Herr Elefant auf dem fliegenden Drachen. Manchmal ist Afrika wirklich zum Lachen. Ob er das weiß? Vielleicht lacht er mit? Wir haben ihn noch nie lachen gesehen. Warum eigentlich nicht?
Die Fahrradklingel am Gartentor. Ostersamstag, Spätnachmittag. Jetzt noch Post? "Nein, keine Post, Sir. Nur Frohe Ostern." – "Oh. Same to you! Und ... einen Moment. Das Ostergeld! Hätten wir fast vergessen, Mr. Njovu."
Ein Leuchten geht über sein Gesicht. Jetzt könne er noch was einkaufen. Ein Huhn und ein Brot.
"Wie bitte?" Karfreitag vorbei, Ostersamstag auch schon fast. Sie haben noch nichts eingekauft?
Nein, er hat das Gehalt für diesen Monat noch nicht. Dabei ist doch sein alter Vater zu Besuch gekommen. Und dann ein Huhn für alle, für ganz Ostern? "Einen Moment noch, Mr. Njovu. Hier, das ist für ein zweites Huhn und den Reis dazu." – "Oh Sir, God bless you."
Es ist ein so wundervolles Gefühl, als weißer Mann Gutes tun zu können. Nur meistens hält es nicht lange an. Ein Tag nach Ostern. Der Stein und die Klingel. "Wie war Ostern, Mr. Njovu?" – "Oh Sir, nochmals vielen Dank, aber es ist etwas Schreckliches passiert." Er zieht das Objekt seiner völligen Zerknittertheit aus der Tasche. Ein geradezu museales Stück Brille. Vielmehr zwei Stück Brille mit nur einem Glas. Sehr starkes Glas. Sehr verkratzt. Der alte Vater sitzt hilflos im compound und jammert. Was soll er machen? Wie soll er eine neue bezahlen? Der alte Mann hat gerade genug Geld für den Bus zurück ins Dorf. Ob ich ihm nicht vielleicht 10 Kwacha leihen könnte. Bis zum nächsten Monat?
Wird das reichen? Doch besser noch 10 Kwacha dazu. Für das Glas. Er wird die Brille auf dem Markt kleben lassen. Und weg ist er.
Der nächste Monat. Ein zerknitterter Mr. Njovu neben seinem Fliegenden Drachen. Ein noch zerknitterter 5-Kwacha-Schein in seinen Händen. Er blickt zu Boden. Mehr kann er nicht zurückzahlen. Aber das ist doch kein Problem. "Lassen Sie sich Zeit." – "Oh vielen Dank, Sir. You are such a good person." Zur betretenen Peinlichkeit bleibt keine Zeit. "Denn … well, you know Sir … mhhhh well …"
"Ja, Mr. Njovu? Ist noch was?" – "Well, Sir, es gibt da ein neues Problem. Meine Frau musste mit einem der Kinder in die Klinik. Und das ist ja schon lange nicht mehr umsonst." – "Wie viel ist es denn?" – "Nun ja, die Gebühren. So um die 5 Kwacha. Aber es hat geeilt und wir mussten ein Taxi an der Straße anhalten." – "Und wie wird sie mit dem Kind zurückkommen?" Das weiß er noch nicht. "Nehmen Sie die 5 Kwacha wieder zurück." Atemlose Pause. "Und … vielleicht noch 10 dazu." Zu den 20 von neulich. Also 30 Kwacha Schulden.
Ein entsetzliches Gefühl, lange Diskussionen auf unserer Veranda. Sollten wir ihm das Geld schenken? Das wäre die alte, widerliche weiße Spendermentalität. Sie macht ihn nur abhängig von uns. Das geht dann immer so weiter. Und was, wenn wir nicht mehr da sind? Er muss lernen, einen Kredit zurückzuzahlen. Wie viel sind 30 Kwacha für ihn?
Wahrscheinlich nicht viel weniger als ein Monatsgehalt. Aber ich habe ihm doch gesagt, er könne sich Zeit lassen. Afrikanische Geldverleiher in den Compounds nehmen 30 Prozent Zinsen. Also bitte, wenn er es bei uns nicht schafft, wie dann?
Nach einer Woche keine Post mehr, kein Klingeln. Wir warten. Nichts. Ich erkundige mich beim Postvorsteher. Nein, Mr. Njovu ist nicht krank, aber er ist auch nicht da. "Sie bekommen keine Post mehr? Warten Sie, bitte." Er kommt mit einem ganzen Stapel zurück. "Das muss ein Versehen sein, Sir. Thank you, Sir."
Wieder keine Post. Eine ganze Woche. Wieder zum Postamt. Diesmal ist Mr. Njovu krank. "Ich wollte Ihnen die Briefe morgen vorbeibringen, Sir", sagt der Postvorsteher.
Noch eine Woche keine Post. Ein Gespräch mit dem Vorsteher unter vier Augen. Irgend etwas stimmt hier doch nicht. Was ist es?
Er drückt herum, er rutscht auf dem Stuhl. "Ist was mit seiner Frau?" – "Oh nein, Sir." – "Hat er geklaut?" – "Gott helfe, nein, Sir." Betretenes Schweigen. Zögerlich endlich die Antwort: "Mr. Njovu kann nicht mehr zu Ihrem Haus kommen. Er schämt sich so sehr. Er hat alles probiert, aber er kann einfach seine Schulden nicht zurückzahlen. Bitte, Sir, verzeihen Sie ihm."
Ich eile nach Hause und schreibe einen Brief: "Dear Mr. Njovu. Ab heute sind alle Ihre Schulden für immer erledigt und vergessen. Morgen früh möchten wir Sie wieder an unserem Haus als unseren Briefträger begrüßen. Wir warten auf Sie." Und am nächsten Morgen steht er am Gartentor, der kleine Mr. Elephant neben seinem Fliegenden Drachen und lächelt zum ersten Mal. Mit diesem Tag beschlossen wir, Mr. Njovu und den vielen, die nach ihm kamen, nie wieder Geld zu leihen. Sondern wenn, dann zu verschenken.
Wolfram Frommlet: "Johann Sebastian Bach geht über den Sambesi – Reisen in die Schatten Europas", Kröner Verlag, 350 Seiten, 28 Euro.




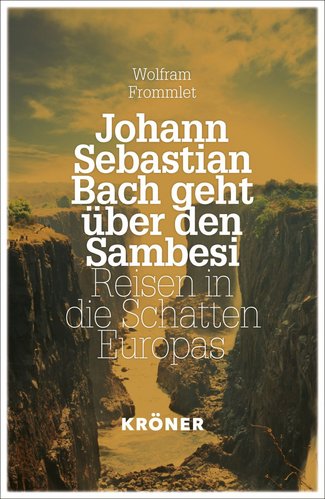









0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!