Die Auseinandersetzungen über Krieg und Frieden, über den Ukraine- oder Gazakrieg verlaufen heutzutage oft geradezu feindselig. Wer öffentlich nach Motiven, Gründen oder Ursachen fragt, wird nicht selten abfällig als "Versteher" verschmäht, obwohl – oder gerade weil – Verstehen nach Hannah Arendt auch die Möglichkeit der Versöhnung eröffnet. Doch das widerspricht der Freund-Feind-Haltung, die nur den Kampf zweier unversöhnlicher Lager kennt und die unsere Diskussionskultur derzeit prägt. Nach der ausgerufenen "Zeitenwende" wirkt dies wie eine freiwillige mentale Kriegsertüchtigung.
Zwischen zwei Lagern dürften sich auch die Aktivistinnen und Aktivisten gesehen haben, die sich einst, mitten im Kalten Krieg weigerten, sich auf die eine oder andere Seite großer Mächte zu schlagen, und die Ostermärsche ins Leben riefen. Sie entwickelten eine eigene Perspektive, die auch zur Grundlage für die Neue Linke, die spätere Studentenbewegung und zahlreiche Bürgerbewegungen werden sollte. Damit provozierten sie die Gesellschaft zum Nachdenken über sich selbst. Eine Perspektive, die zurückzugewinnen sich lohnen könnte.
Als das Londoner "Direct Action Commitee" im April 1958 alle Gegner der atomaren Aufrüstung – "egal, ob sie eine britische, amerikanische oder russische Regierung haben" – zu einem Protestmarsch zur 84 Kilometer entfernten Atomforschungsanlage in Aldermaston aufrief, kamen 8.000 Menschen zur Abschlussveranstaltung zusammen. Daraus entstand eine internationale Kampagne für nukleare Abrüstung und die bis heute jährlich stattfindenden Ostermärsche.
Kritik an Regierungen im Osten wie im Westen
Einige der Londoner kooperierten mit einer Gruppe junger Leute um die Zeitschrift "The New Reasoner", aus deren Kreis 1959 erstmals zur Gründung einer Neuen Linken aufgerufen wurde. Sie sahen sich als "erste Generation des atomaren Zeitalters", beklagten die "politische Apathie" in der Gesellschaft und kritisierten sowohl die Regierungen des Westens wie auch des Ostens als autoritär und undemokratisch. Aus der Kritik an beiden Systemen leitete die Neue Linke auch die Forderung nach militärpolitischer Neutralität ab – und diese rief die "heftigsten Anfeindungen des Establishments hervor", hieß es in einem Gründungstext.






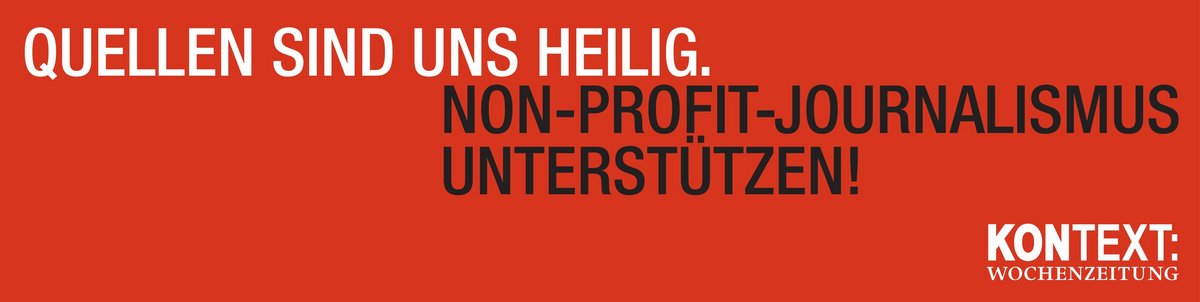











1 Kommentar verfügbar
-
Antworten
Ich halte die Annahme der Autorin, dass Russland nicht willens sei, die NATO anzugreifen in dieser Pauschalität für falsch.
Kommentare anzeigenBenedikt R.
vor 2 WochenWenn man General a.D. Wolfgang Richter, Markus Reisner und Jeffrey Sachs als Kronzeugen der eigenen These anführt, sollte man vielleicht auch erwähnen, dass ein Großteil der…