In einem Laboratorium voller Tiegel und Phiolen, umstellt mit Büchern ringsherum, "sitzt Bruder Berthold, eingewiegt // In grübelnde Gedanken": So malte sich der Freiburger Schriftsteller August Schnelzer in einem Gedicht von 1846 die Kulisse in aus, in der alchemistische Experimente zu einer durchschlagenden Entdeckung geführt haben sollen – auch wenn Ordensbruder Berthold Schwarz dabei eigentlich andere Absichten verfolgte:
Er sucht umsonst die Goldtinktur,
Es will ihm nicht gelingen
Dem Zaubermeister der Natur
Den Schlüssel abzuringen;
Er stampft im Mörser ämsiglich
Salpeter, Kohlen, Schwefel,
Und rief' den Teufel gern zu sich,
Wär's nur kein solcher Frevel.
Nun schürt die Glut er wieder frisch,
Daß alle Funken spritzen,
Und einer springt in das Gemisch
Und plötzlich jagt mit Blitzen
Die Mörserkeul' ein Donnerschlag
An des Gewölbes Decken;
Geschleudert auf den Boden lag
Der Mönch im Todesschrecken.
Die Entdeckung des Sprengstoffs durch einen Arbeitsunfall: Von dieser Geschichte gibt es im deutschen Sprachraum unzählige Variationen. In einigen Versionen sollen etwa erschrockene Brüder herbeigeeilt sein und sie konnten den ins Deckengebälk katapultierten Stößel nicht mehr herausziehen, obwohl sie kurz zuvor sogar Reliquien der heiligen Barbara berührt hätten. Daher unterstellt eine volkstümlich-pseudowissenschaftliche Etymologie, dass das Schwarzpulver nach Berthold Schwarz benannt sei, militärische Mörser aufgrund dieses Vorfalls so hießen und die heilige Barbara seither nicht nur als Schutzpatronin der Bergleute, sondern auch der Artillerie gelte.
Nichts davon lässt sich belegen. Eine der frühesten überlieferten Darstellungen der angeblichen Entdeckungsgeschichte findet sich in Felix Hemmerlins "Über den Adel und die Bauernschaft", entstanden um 1450. In dieser Version suchte der "Schwarze Berthold (Bertholdus niger), ein allgemein bekannter, feiner Alchimist" nicht nach einer Goldtinktur, sondern nach einer Methode, Quecksilber hammerfest zu machen. In Hemmerlins – vom Denken der Zeit geprägten – Worten, musste der Alchemist dazu zunächst dem Quecksilber seinen "Geist" austreiben. Als dies misslang, "beschloss der Schwarze Berthold eine andere Prozedur. Geistreich, wie er war, kam er auf folgenden Gedanken, den 'Geist' samt dem Quecksilber selbst zu vernichten: Er wusste, dass Gegensätze einander nicht dulden, und tat deshalb, um das Quecksilber ihrem Kampfe auszuliefern, den von Natur feurigen Schwefel und den kalten Salpeter mit dem Quecksilber in ein Gefäß aus Erz zusammen, verschloß dieses und setzte es dem Feuer aus."
Da ein entzündeter Schwefel laut Hemmerlin nicht mehr neben kaltem Salpeter existieren kann, habe es die Büchse daraufhin unter einem furchtbaren Knall zerrissen. "Durch dieses Ereignis aufmerksam geworden, experimentierte Berthold weiter, er band starke Metallgefäße mit Eisen und wiederholte die obige Prozedur. Sie zerrißen und schlugen die Wände des Laboratoriums in Stücke." Doch Glück und Zufall allein reichen nicht aus, um groß herauszukommen: Berthold habe seine Prototypen schließlich "durch seinen Erfindungsgeist zum Staunen aller" weiterentwickelt "zu dem, was wir jetzt uneigentlich Büchsen nennen, und da er seine Erfindung von Tag zu Tag verbesserte, so kam es, daß sie alle früheren Kriegsinstrumente übertraf".
Freiburg wollte keinen gewöhnlichen Steinhauer
Enthalten sind alle Kernelemente einer deutschen Erfolgsgeschichte, wie sie auch über 500 Jahre später noch gerne erzählt wird: Fleiß und Erfindergeist als Grundlage für Innovationen, die die Welt verändern. Der Stolz auf die alle früheren Kriegsinstrumente überragenden Entdeckung veranlasste die Stadt Freiburg vor etwa 170 Jahren, eine Statue auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus aufzustellen: Sie zeigt Berthold Schwarz in nachdenklicher Pose.
Bei der Gewährung finanzieller Mittel für das Denkmal griffen der Freiburger Bürgermeister und der Gemeinderat tiefer in die Tasche als zunächst beabsichtigt. Ursprünglich war die Auftragsarbeit für maximal 1.650 Gulden ausgeschrieben. Angebote von Ignatz Michel und Ludwig Hügle wurden abgelehnt, weil die Kommunalpolitik keine "gewöhnlichen Steinhauer" wollte. Schließlich fiel die Wahl auf den bekannteren Josef Alois Knittel, der einen Promi-Preis von 2.700 Gulden aufrief – und die Arbeit schließlich seinen Schüler Joseph von Kopf machen ließ.





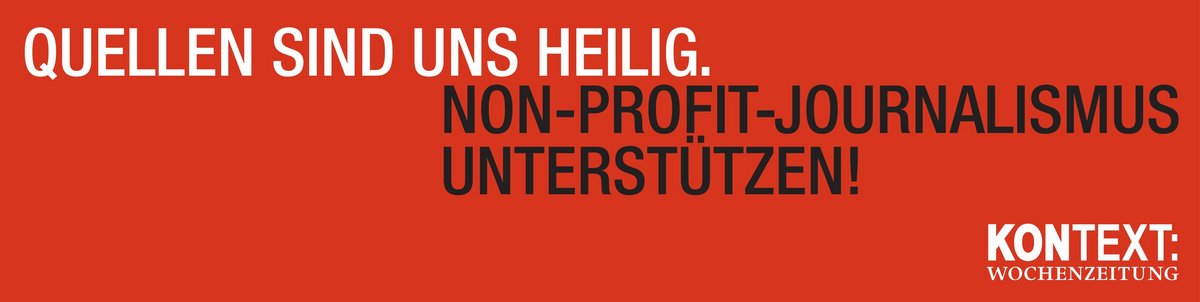

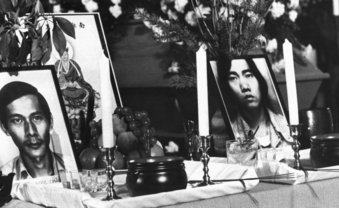






0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!