Und selbst wenn die Landespflegekammern bundesweit als Interessenorganisationen unter ihren Mitgliedern große Zustimmung hätten und sogar mit einer starken Stimme sprechen würden, bliebe ein Konstruktionsfehler: "Die Pflege", die "eine starke Stimme" braucht, ist mehr als die examinierten Fachpfleger:innen. Auf Stationen, in Wohnbereichen und mobilen Pflegediensten arbeiten viele Menschen in Kontakt mit zu Pflegenden, die bei dieser Kammerkonstruktion nicht berücksichtigt sind: Alltagsbegleitungen, Pflegehelfer:innen, medizinisch-technische Assistent:innen, Therapeut:innen, auch Reinigungskräfte sind tagtäglich im Kontakt mit Patient:innen und Bewohner:innen. Auf ganz unterschiedliche Weise tragen diese Berufsgruppen zu Sorge und auch zu Heilung bei. Eine freiwillige Mitgliedschaft ist für andere Berufsgruppen zwar möglich, mit Blick auf Beitragssätze, Verdienst und konkreten individuellen Ertrag jedoch unrealistisch.
Befürworter:innen der Kammern, so lässt es der bisherige Eindruck vermuten, finden sich vor allem bei Akademiker:innen, Leitungen, Ausbilder:innen. Das ist nicht verwerflich, es sollte jedoch deutlich kommuniziert werden und eine Debatte über die unterschiedlichen Interessen vor einer Einführung forciert werden.
Der gepflegte Mensch als bearbeitetes Objekt
Schaut man auf die beruflichen Hintergründe der Befürworter:innen, wird das zweite große Anliegen der Kammer verständlich: professionelle Autonomie durch Selbstverwaltung und Weiterbildung. Die Kammer bildet institutionell ein technisch orientiertes Verständnis der Professionalisierung der Pflege ab. Verpflichtend ist sie nur für examinierte oder akademisierte und damit "professionelle" Pflege. Diese dokumentiert, evaluiert, plant, berät, sichert Qualität. Die Pflege "am Bett", am Mittagstisch und beim Nachmittagskaffee erledigen zumeist die Helfer:innen und Alltagsbegleitungen. Die stationäre Pflege gleicht damit einem tayloristischen Unternehmen, wo Handgriffe klein- und arbeitsteilig organisiert werden. Bei aller Notwendigkeit von Planung und wirtschaftlicher Steuerung birgt diese Form der Arbeitsorganisation die Gefahr, den gepflegten Menschen zum bearbeiteten Objekt zu machen.
In vielen Bereichen wurde die tayloristische Arbeitsteilung längst von der indirekten Steuerung abgelöst. Weg vom Handgriff, hin zur Ergebnisverantwortung. Von dieser Führungsstrategie leiht sich das Kammerprojekt eine andere große Idee aus, deren Grenzen ebenfalls hinlänglich bekannt sind: Die examinierte Pflegekraft wird ihres eigenen Pflege-Glückes Schmied. Rechenschaft über die geleistete Arbeit mittels Dokumentation und Eigenverantwortung bei der fachlichen Weiterqualifikation. Die Berufsordnung der rheinland-pfälzischen Kammer stellt fest: Aus einem Recht auf lebenslanges Lernen ergibt sich die Pflicht zur kontinuierlichen Fortbildung, denn "die Kammermitglieder tragen Verantwortung für die ihnen anvertrauten Menschen mit Pflegebedarf".
Sollten Kammermitglieder aufgrund "organisatorisch-fachlicher Rahmenbedingungen" nicht in der Lage sein, diese Verantwortung wahrzunehmen, müssen sie dies gegenüber ihren Vorgesetzten anzeigen, so die Ordnung weiter. Bei etwaigen Konflikten steht die Kammer beratend und unterstützend zur Seite. Auf den ersten Blick sind das hilfreiche Regelungen, auf dem zweiten Auge sind sie blind für die strukturellen und politischen Ursachen, die Pflegepersonen an der verantwortlichen Ausübung ihres Berufs hindern. Zeitmangel für individuelle Pflege, unzuverlässige und überbordende Arbeitszeiten und damit soziale, körperliche und psychische Überlastung werden mit zusätzlichen Pflichten nicht behoben. Für die Arbeitgeber, die Zeit einräumen müssten für Fortbildung, Dokumentation und vor allem pflegerische Zuwendung, gilt diese Ordnung nicht. Die Haftbarkeit wird klar verteilt, verantwortlich sind zunächst die Pflegekräfte. Und die Kammer? Sie berät.
Wären Care-Räte eine Alternative?
Schielt man in diesem Zusammenhang einmal hinüber zu den heimlichen Vorbildern der Pflegekammer, werfen sich Fragen auf: Warum schafft es die stramm in Kammern organisierte Ärzteschaft nicht, die Fallpauschalen-Finanzierung im Krankenhaus abzuschaffen? Das große Damoklesschwert, das über dem ärztlichen Ethos hängt und alltäglich unzumutbare Entscheidungssituationen zwischen Patientenwohl und Jahresbilanz erzwingt. Mit einer Kammer scheint man der allgegenwärtigen Ökonomisierung und ihren strukturellen Fehlanreizen nicht beizukommen – sehr wahrscheinlich auch nicht, wenn es zwei davon gibt.
Lässt sich also irgendetwas aus dieser neuerlichen Initiative lernen? Welchen Stein könnte der Sisyphos im Ministerium ins Rollen bringen? Sicherlich richtig ist die Einschätzung, dass im Gesundheits- und Pflegesektor mehr Politik nötig ist. Die Pflege hat, auch geschichtlich betrachtet, kein politisiertes Berufsverständnis. Um die gesellschaftliche Relevanz ihrer Arbeit wissen die Pflegenden, aber auch um deren politische Gestaltbarkeit?
Womöglich setzt schon das Ringen um die Pflegekammer eine Entwicklung in diese Richtung in Gang. Es braucht definitiv eine breitere gesellschaftliche Auseinandersetzung, wie wir die Probleme in diesem System bearbeiten wollen. Es braucht Streit und Transparenz darüber, wie wir pflegen und heilen und geheilt und gepflegt werden wollen. Es braucht aus dem Streit resultierende politische Entscheidungen. Fraglich bleibt, ob die Lösung im augenscheinlichen Rückzug der Landespolitik und einer organisatorisch aufwändigen erzwungenen Parlamentarisierung einer pflegerischen Berufsgruppe liegt.
Die Debatte darüber ist noch nicht am Ende. Wären nicht Care-Räte eine Alternative? Warum nicht Gesundheitskammern, in denen alle Berufs- und Interessengruppen ihre Ziele transparent machen müssen und nicht "eine Stimme" gezwitschert wird, sondern offenliegt, wer welchen Nutzen hat? Müssen wir nicht insgesamt das Verhältnis von Daseinsvorsorge und Markt überdenken? Warum kein Social New Deal? Ein Investitionsprogramm mit 200 Milliarden für Kliniken, Heime und die unzähligen Privathaushalte, in denen tagtäglich gepflegt wird. "Think big und viele kleine Schritte!" möchte man in dieses und all die anderen verwandten Ministerien hineinrufen. Der Hang, den der schwere Stein hinauf muss, ist lang und steil.
Michael Brugger ist Betriebsseelsorger und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theologische Ethik/Sozialethik der Universität Tübingen. Stefan Saviano ist Altenpfleger und Philosoph. Aktuell studiert er Pflegewissenschaften in Esslingen.




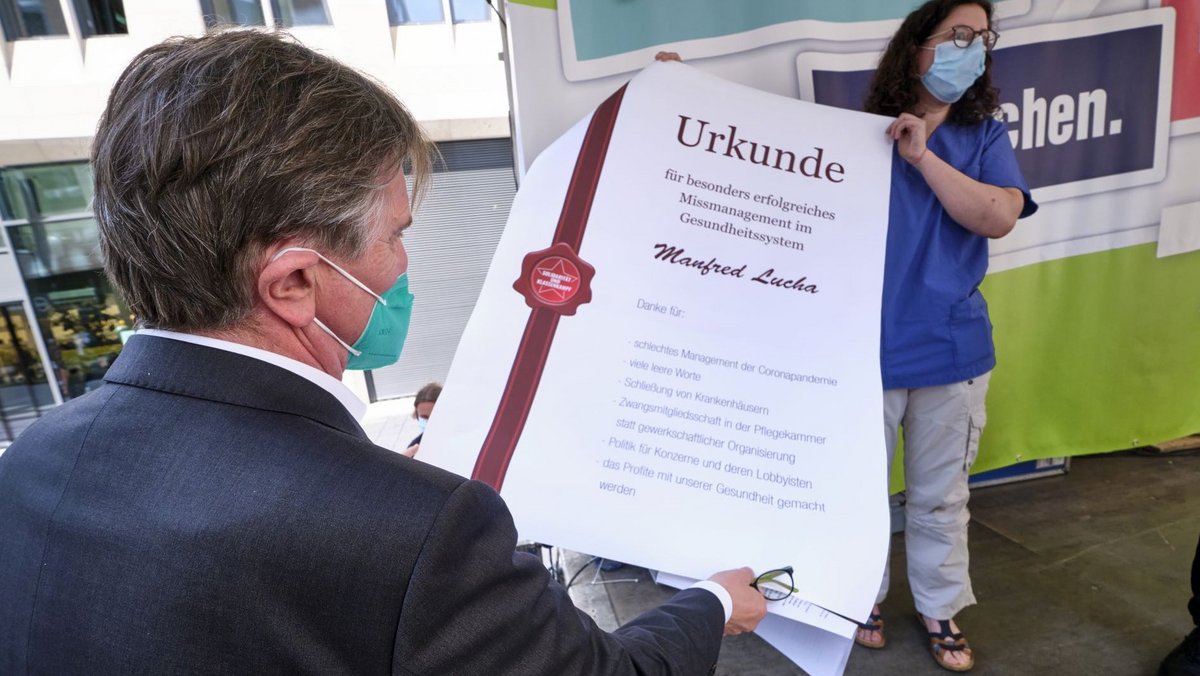









1 Kommentar verfügbar
-
Reply
Oh schön, schon wieder äußern sich Menschen zur Pflege.
Kommentare anzeigenKaren Lechni
atEin Betriebsseelsorger und ein Gewerkschafter...