Es war wie ein Lockangebot im Elektromarkt: fünf Jahre Software für 25 Millionen Euro, sofort zuschlagen. Ein Staatssekretär im Innenministerium von Thomas Strobl (CDU) tat genau das – im Alleingang, ohne Rechtsgrundlage, ohne den Koalitionspartner einzuweihen. So landete Baden-Württemberg bei Palantir, jener US-Firma, die sonst Geheimdienste und Militär beliefert. Die Grünen erfuhren aus der Zeitung von dem, was ihr Innenpolitiker Oliver Hildenbrand später ein "Palantir-Desaster" nannte. Einsetzen darf die Polizei Palantir bislang nicht, es fehlt die Rechtsgrundlage.
Mit Palantir sollen große Datenmengen zu verarbeiten und für die Polizei auswertbar werden. Die Software verknüpft Daten aus verschiedenen Quellen und stellt Zusammenhänge zwischen Personen, Orten und Ereignissen auch visuell dar. Das verändert vor allem, wie Ermittler:innen Daten abrufen und miteinander vergleichen können. Die Polizei kann Querverbindungen zwischen Fällen prüfen und Spuren systematisch abgleichen.
Mit einer Neufassung des Polizeigesetzes will die Landesregierung den Einsatz von Palantir als "Verfahrensübergreifende Recherche- und Analyseplattform (VeRA)" legalisieren. Der Entwurf ist Ergebnis eines grün-schwarzen Deals nach einem Koalitionsstreit: Für die Grünen gibt es laut SWR 1.500 Hektar mehr für den Nationalpark im Schwarzwald, für die Schwarzen eine Rechtsgrundlage für Palantir. Ohne das neue Polizeigesetz bliebe die millionenschwere Software ungenutzt. Herausgehandelt haben die Grünen zudem eine parlamentarische Kontrollkommission und die Zusage, Palantir nur befristet zu nutzen – möglichst bald soll eine europäische Alternative folgen. Derzeit läuft der Palantir-Vertrag über fünf Jahre.
Sekunden statt Tage
Bis Anfang 2026 soll das neue Polizeigesetz, das den Einsatz der Palantir-Software Gotham regelt, im Landtag verabschiedet werden. Danach wird nochmal etwas Zeit vergehen, bis baden-württembergische Polizist:innen Palantir tatsächlich nutzen könnten. Im zweiten Quartal 2026 und damit mehr als ein Jahr nach Vertragsabschluss sei das System einsatzbereit, heißt es vom Landesinnenministerium. "Der Aufbau der Infrastruktur und die Tests brauchen ihre Zeit."












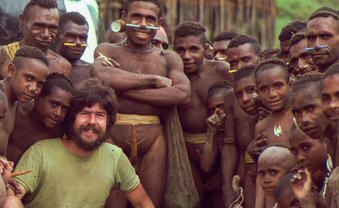



4 Kommentare verfügbar
-
Antworten
"Der Quellcode ist geheim, selbst Parlamente und Datenschützer haben keinen Einblick."
Kommentare anzeigenPalantir - ick fürchte dir!
am"Das Fraunhofer Institut hat den Quellcode untersucht und keine Funktionalitäten festgestellt, die einen unzulässigen Datenabfluss oder einen unautorisierten Systemzugriff ermöglichen", so das Innenministerium…