Wie erleben Sie, was das mit den Familien macht?
Viele Erwachsene essen weniger, damit ihre Kinder wenigstens eine Mahlzeit am Tag bekommen. Besonders Kinder leiden massiv unter der Mangelernährung, sie beeinträchtigt Wachstum, Konzentration, geistige und körperliche Entwicklung.
Was müsste sich ändern?
Es muss sofort aufhören, dass die Zivilbevölkerung so unter diesem bewaffneten Konflikt leidet. Für uns ist klar: Es braucht nicht nur Hilfe, sondern auch Sicherheit. Doch in Gaza gibt es keinen einzigen Ort, an dem Zivilist:innen sicher sind, auch nicht die Helfer:innen.
Wie lange kann man unter solchen Bedingungen durchhalten?
Fast jeder Mensch in Gaza ist inzwischen mehrfach vertrieben worden. Die Widerstandskraft schwindet – körperlich, psychisch und finanziell. Anfangs konnten sich viele noch mit Erspartem helfen, aber diese Reserven sind längst aufgebraucht. Zur Versorgung braucht es täglich rund 500 Lkw, diese Zahl wurde seit Oktober 2023 nie erreicht.
Die Versorgung übernimmt jetzt die von Israel und den USA unterstützte neue Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
Ja, es gibt Hilfe, aber die entspricht nicht den Grundsätzen humanitärer Hilfe. Humanitäre Hilfe muss allein nach dem Maß der Not geleistet werden. Doch wenn sie nur an wenigen, stark militärisch gesicherten Orten verteilt wird, erreichen wir die Schwächsten nicht: Kinder, Alte, Pflegebedürftige. Das widerspricht dem Grundsatz der Unparteilichkeit – und führt zur Politisierung und Militarisierung von Hilfe. Genau das darf nicht passieren.
Zuletzt gab es auch Tote bei der Verteilung.
Ja, leider. Seit Ende Mai sehen wir in unserem Feldkrankenhaus in Rafah einen massiven Anstieg an Verletzten, oft mehr als 150 Menschen innerhalb kürzester Zeit an einem Tag. Viele von ihnen berichten, dass sie beim Versuch verletzt wurden, eine Verteilstelle für Hilfsgüter zu erreichen. Manche kommen gar nicht mehr lebend im Feldkrankenhaus an. Diese sogenannten Massenanfälle von Verletzten passieren fast immer in zeitlicher Nähe zu angekündigten Hilfsverteilungen. Es zeigt, wie gefährlich der Zugang zu Hilfe geworden ist. Vor allem, wenn sie nicht dort ankommt, wo die Menschen tatsächlich sind.












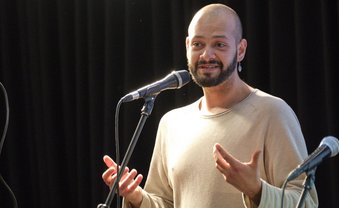






3 Kommentare verfügbar
-
Antworten
"Ganz Gaza ein unschuldiges Babybett, das grundlos, brutal und pausenlos von den blutrünstigen Israelis attackiert wird..."
Kommentare anzeigenFriedlieb
amWas für ein widerlicher Kommentar angesichts der durch Kopfschüsse von IDF-Snipern ermordeten Kinder: …