"Zwei Jahre ist es her, da konnte ich die eigene Unschlüssigkeit nicht länger ertragen", beginnt der polnische Autor Sczcepan Twardoch seine Eröffnungsrede zum zweiten Stuttgarter Literaturfestival, "und fuhr an die Front." Mit Geländewagen, die er über ein Fundraising finanziert hatte. Seine Rede im Literaturhaus wirkt wie eine Fortsetzung seines neuesten Romans "Die Nulllinie": Ein Bericht von seinem letzten Frontausflug im Januar.
Die Fahrt sei gefährlicher als der Schützengraben, konstatiert Twardoch und erzählt von FPV- (First Person View), Mavic- und Antal-Drohnen, den größeren Hexacoptern namens Fury, Shark und Flyeye, die es dort vor zwei Jahren allesamt noch nicht gab. Ein Wald von Antennen auf dem Dach des Jeep – das radioelektronische Abwehrsystem REB – sendet Störsignale. "REB ist unser Leben", sagt sein Fahrer, der 60-jährige Oleg. Wenn auf dem Monitor das Bild des eigenen Fahrzeugs erscheine, helfe nur noch, sofort herauszuspringen.



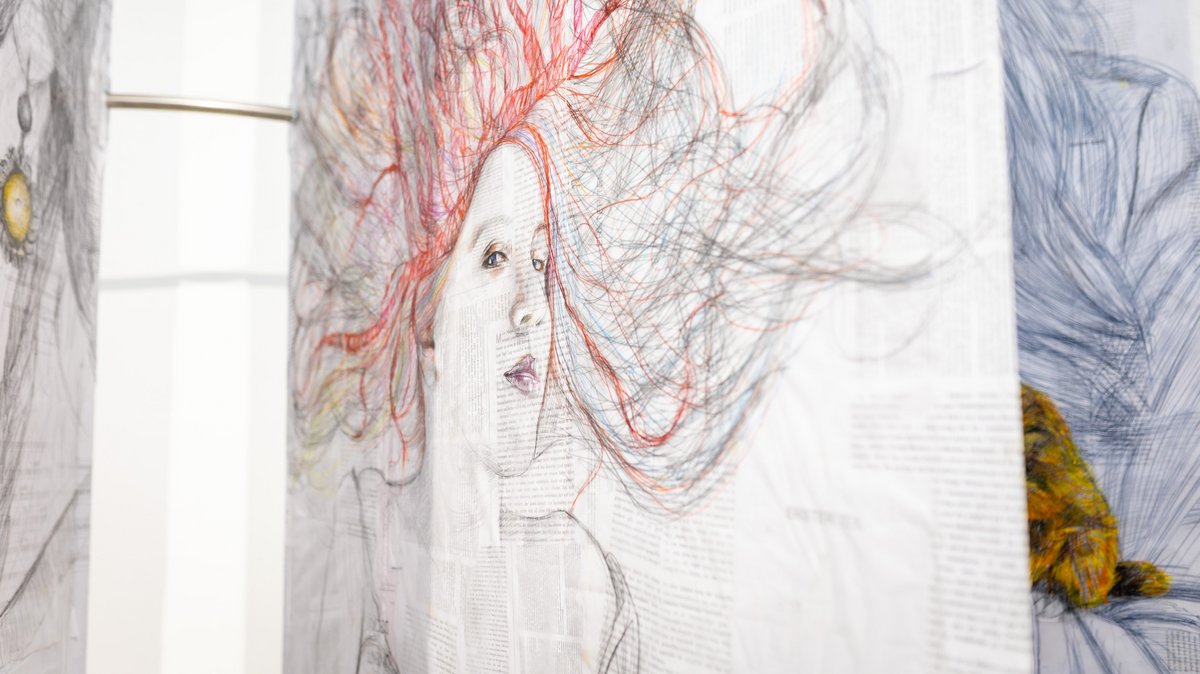













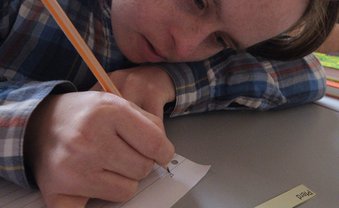



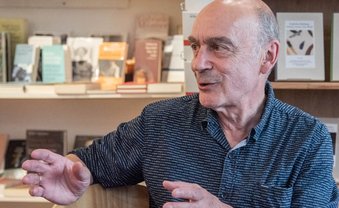



0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!