"Das ist nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellen sollte", sagt Udo Lutz, der den Antrag für die SPD-Fraktion federführend bearbeitet hat, heute allerdings nicht mehr im Gemeinderat sitzt. "Der Antrag ist am 4. November im Schnelldurchgang beantwortet worden. Der Verein Zeichen der Erinnerung war in keinster Weise eingebunden. Es gab kein Gespräch über mögliche Spielräume, wie das Umfeld der Gedenkstätte hätte gestaltet werden können. Nach eineinhalb Jahren muss eine solche qualifizierte Antwort möglich sein."
Am 4. November ist das Thema im Ausschuss Stuttgart 21/Rosenstein als zweiter von vier Tagesordnungspunkten behandelt worden. Die Bahn habe den Rückbau der Gleise beantragt, bekamen die Ausschussmitglieder zu hören, das Eisenbahn-Bundesamt habe dies vor einem Jahr, am 25. November 2024 genehmigt. Die Bahn wolle auf dem Areal Mauereidechsen ansiedeln. Darüber hätten sich Bahn und Stadt mit Andreas Keller, dem Vorsitzenden des Vereins "Zeichen der Erinnerung", noch einigen können. Beim Rundgang über das Areal im März schlug Keller vor, wenn die Bahn nicht wisse, wohin mit den gleich nebenan abgesammelten Tieren: Auf dem Schotter der Gedenkstätte und ihres Vorfelds sei Platz genug. Das Umweltamt hat im Juli bestätigt, dass dies möglich sei.
Kürzere Wartezeit für obskuren Kriegsenkel
In ihrer insgesamt etwas undurchsichtigen Kommunikationsstrategie beruft sich die Stadt im mündlichen Bericht vor Gemeinderäten auf einen obskuren "Stuttgarter Kriegsenkel", der mit der Bitte an sie herangetreten sei, wenigstens zwei der fünf Gleise zu erhalten. Und während ein fraktionsübergreifender Antrag seit eineinhalb Jahren der Bearbeitung harrt, ging es in dem Fall schneller. Nach ämterübergreifenden Abstimmungen habe die Stadt daraufhin am 23. September der Bahn mitgeteilt, sie könne auf die Entfernung des Schotters und zweier Gleise auf einer Länge von 200 Meter verzichten. Ganz am Ende des mündlichen Berichts war dann noch von einer Mitteilung an den Verein Zeichen der Erinnerung die Rede.
Andreas Keller weiß davon nichts. Bei ihm hat sich niemand gemeldet. Er hat bereits im Juli, als ihn die Stadt mit der Otto-Hirsch-Auszeichnung ehrte, an Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) geschrieben: "Wir bemühen uns seit Jahren darum, dass das Gleisfeld vor der Gedenkstätte" erhalten werde. Doch eine Antwort Noppers steht aus. Bleibt abzuwarten, ob Udo Lutz mehr Erfolg hat. Er hat dem Chef der Verwaltung ebenfalls einen Brief geschrieben, in dem er moniert, wie "durch den Abbau von drei Gleisen Fakten geschaffen" wurden.
Die Reaktionen der in der Gedenkstättenarbeit Aktiven sind einhellig. "Es ist eine Unverschämtheit, den Antrag einfach nicht zu behandeln und mit dem verdienten Andreas Keller nicht das Gespräch zu suchen", protestiert Michael Kienzle, Vorstand der Stiftung Geißstraße. Er hat 2001 mit einem "Denkblatt" den Anstoß zur Einrichtung der Gedenkstätte gegeben. "Die Empörung über das Verfahren ist völlig berechtigt", sagt Kienzle.
Gedenkorte erst nach Druck der Zivilgesellschaft
"Wir finden vor allem beunruhigend, dass die Gedenkstätte Zeichen der Erinnerung nicht in die Planung einbezogen ist", stimmt Elke Banabak im Namen des Hotel-Silber-Vorstands zu. "Dass ein Antrag mehrerer Gemeinderatsfraktionen zu dem Thema seit 2024 nicht beantwortet wird, und dass man stattdessen auf diese Art mit der Entfernung von drei von fünf Gleisen vollendete Tatsachen schafft, ist respektlos und auch eine grobe Missachtung öffentlichen Interesses."
Stuttgart habe nur zwei wichtige Erinnerungsorte, hat die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, Professorin in Konstanz, im Juli bei der Vorstellung der städtischen Leitlinien zum Thema festgehalten: Zeichen der Erinnerung und Hotel Silber. Beide seien vor allem dem Druck der Zivilgesellschaft zu verdanken, während die Stadt lange gezögert habe. Bleibt nur zu ergänzen, dass es viele weitere Gedenkorte gibt, wenn auch zumeist gut getarnt, kaum sichtbar oder abgelegen.









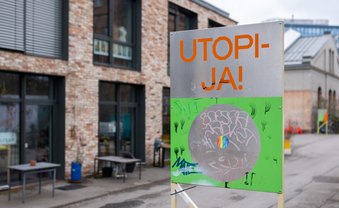






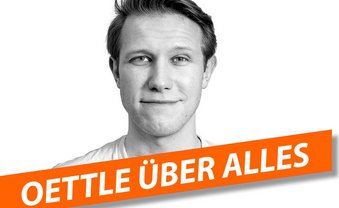


0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!