Der Vorgang ist ohne Beispiel und hätte in anderen Zeiten für viel Aufregung gesorgt, so oder so. Denn einerseits ist es recht ungehörig, wenn der Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB) die CDU-Kultusministerin beim grünen Regierungschef verpetzt. Andererseits ist die vorgebrachte Kritik Ausdruck von Verzweiflung, weil sich viele Familien nicht mehr zu helfen wissen. Carsten Rees, der das Beratungsgremium nach etlichen Turbulenzen 2014 übernahm und befrieden konnte, informierte Kretschmann Ende Mai über die Art, mit der die Ministerin "über die Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Elternschaft und der Kinder hinwegregiert – nach den letzten Wochen ist man geneigt zu sagen: hinwegfegt". Zugleich vermeide Susanne Eisenmann es, "die Elternschaft in den Prozess der Corona-Politik des Kultusministeriums einzubeziehen".
Winfried Kretschmann müsste das schon deshalb interessieren, weil es dem demokratisch legitimierten LEB zusteht, vom Kultusministerium "über die wichtigen allgemeinen Angelegenheiten" unterrichtet zu werden und "die notwendigen Auskünfte" zu bekommen. Auch solle das Ministerium dem Landeselternbeirat allgemeine, die Gestaltung und Ordnung des Schulwesens betreffende Regelungen vor ihrem Inkrafttreten zuleiten, besagt Paragraph 60 des Schulgesetzes. Die Wirklichkeit war eine andere: Wichtige Neuigkeiten, vor allem, wann einzelne Jahrgänger unter welchen Bedingungen wieder zurück dürfen in den klassischen Unterricht, erfuhr die Elternvertretung nur, weil sie in der Zeitung standen. "Zu Beginn der Krise gab es ein kurzes Telefonat der Ministerin mit dem Vorsitzenden des Landeselternbeirates", klagt Rees in seinem Beschwerdebrief, "seither herrscht Funkstille."
Offiziell sagt der Ministerpräsident gar nichts zu dem Hilferuf des Freiburger Biologen, außer dass er ihn ans zuständige Ressort weiterleitet. Hinter den Kulissen wundern sich nicht nur Grüne über Eisenmanns Verhalten, weil es mit Blick auf die Landtagswahl höchst riskant ist, immer mehr Eltern gegen sich aufzubringen. Allerdings, so heißt es in der grünen Landtagsfraktion, werde der Amtsinhaber seiner Herausforderin mitnichten den Gefallen tun, sich öffentlich mit ihr anzulegen. Und einen Trumpf hält die promovierte Germanistin ohnehin in der Hand: Wenn Beiräte und Vertretungen immer schärfere Töne anschlagen, wird ein Keil in die Gremien getrieben. Die Gangart, das weiß die Ministerin nur zu gut, trifft nämlich keineswegs nur auf Zustimmung.
Die Siebziger wollen ihre Zankäpfel zurück
Auf diese Weise nützt Eisenmann sogar noch, die vielen Rügen einfach misszuverstehen, zu ignorieren, oder zu kontern mit detaillierten Auskünften dazu, wie "mein Haus", "mein Amtschef", "meine Mitarbeiter" den Kontakt pflegten: zu Kommunen und Verbänden, zu Schulleitungen und Gewerkschaften, wöchentlich oder zwei-wöchentlich seit Beginn der Krise. "Ein Kultusminister ist immer sehr beliebt, wenn's darum geht, angegriffen zu werden", sagt sie einigermaßen eingeschnappt, "damit lebe ich gut."
Andere allerdings nicht, weil sie direkte Kontakte in ihrer Aufstellung "nach Stunden und Tagen" nicht präsentieren kann. Und weil ihr Amtschef selbst die eigenen Zeitpläne zum weiteren Vorgehen gerade wieder einmal über den Haufen geworfen hat nach dem Motto: Bitte warten, bitte warten. Erst Ende Juni sollen Vorgaben auf den Tisch, wie’s weiter geht. Nicht nur Väter und vor allem Mütter, sondern gerade Kinder und Jugendliche, die sich durch die Lockdown-Wochen mühen, hätten eine andere Form der Aufmerksamkeit verdient.
Aber SchülerInnen stehen schon lange nicht mehr im Mittelpunkt einer Debatte, die in kaum einem anderen Bundesland von so viel Prestigedenken und Ressentiments getragen wird. Strukturen und Ganztagsschulen beispielsweise sind Zankäpfel, als seien die Siebziger Jahre noch nicht vorüber. Eltern von Gymnasiasten werden von CDU und FDP in dem Irrglauben bestärkt, ihre Kinder seien irgendwie doch etwas Besseres und Lernen fürs Leben allein in homogenen Gruppen das Richtige.
Eisenmann selber will Lehrkräfte zwar vor den "pauschalen Vorwürfen" schützen, zu viele hätten sich eher weggeduckt als engagiert im Homeschooling. Dass sie damit die Attest-Idee erläutert – ab 29. Juni müssen sich Angehörige von Risikogruppen krankschreiben lassen, um weiter von zu Hause aus arbeiten zu können –, zeigt, wie sie selber nicht frei ist von eben dieser Überzeugung. Denn ein Ziel der strengeren Kontrolle ist auch, mehr Lehrkräfte für den Präsenzunterricht zu rekrutieren. "Wir reden an der Grundschule von einer Größenordnung von 20 Prozent, die nicht arbeitet", entfährt es Eisenmann verräterisch. Denn die allermeisten dieser 20 Prozent arbeiten sehr wohl, aber eben daheim, vom Küchentisch aus, per Laptop und/oder Schalte.
Lehrkräftemangel als Dauerthema – schon vor Corona
Aber selbst wenn Ältere oder Vorerkrankte in Scharen an ihren klassischen Arbeitsplatz zurückkehren, wird eine ausreichende Unterrichtsversorgung selbst im nächsten Schuljahr nicht möglich sein, weil Lehrkräftemangel schon vor Corona Dauerthema war. Der Landeselternbeirat hat seines Beratungsamtes bereits gewaltet und "weitsichtige Konzepte für längerfristige Einschränkungen auch nach dem Sommer eingefordert", wie Rees schreibt. "Bei allen Bildungsformen stellt sich die Frage, wie die Rückkehr zum Regelbetrieb verantwortungsvoll gestaltet und ein Höchstmaß an Präsenz sichergestellt werden können, und was diese Rückkehr in effektiven Stunden bedeutet", erklären zwei Dutzend Gesamtelternbeiräte, darunter aus Stuttgart, Konstanz, Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg. Ihr Angebot zur Zusammenarbeit verbinden sie mit einer schallenden Ohrfeige für die Adressatin im Kultusministerium: "Bei aller Diversität der Elternschaft in dieser nie dagewesenen Krise eint uns die Tatsache, dass wir mit Ihrem Krisenmanagement unzufrieden sind."
Die meisten Fleißsternchen im Kampf um Anerkennung hat sich in den Corona-Wochen der Verein der Gemeinschaftsschulen verdient. Aus der Perspektive der Kinder, Jugendlichen und Eltern haben es die von ihm vertretenen Schulen geschafft, dass Vernetzung und digitaler Unterricht, Austausch und gegenseitige Hilfe in der Regel gut funktionierten. Und für die bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit wurde vom Verein – akribisch mit Beispielen belegt, mit Zitaten verlinkt und Erfahrungen gespickt – auf 22 Seiten ein "ABC des Versagens" erstellt. Devise: Jetzt schreiben wir mal auf, was wir der Ministerin gern alles gesagt hätten, wenn sie mit uns spräche. Von A wie Aufstiegsprogramm zur finanziellen Besserstellung von Lehrkräften über D wie Digitalisierung ("Verschludert, verschleppt und verschlafen") und N wie Noten ("Wir sagen zur Ministerin: Ungenügend. Sechs, setzen – oder besser: abtreten!") bis Z wie Zukunft reicht die geharnischte Anklage. Dass sie jede einzelne Missbilligung mit Fundstellen belegen, begründen die AutorInnen damit, "dass sich die groben Versäumnisse der Kultusministerin in wenigen Worten nicht mehr zusammenfassen lassen".










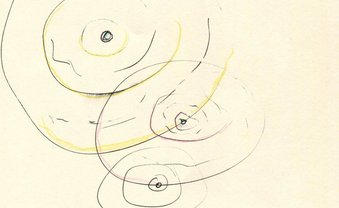


2 Kommentare verfügbar
-
Reply
Im Artikel Susanne Eisenmann: "Ein Kultusminister ist immer sehr beliebt, wenn's darum geht, angegriffen zu werden", sagt sie einigermaßen eingeschnappt, "damit lebe ich gut."
Kommentare anzeigenJue.So Jürgen Sojka
atGut, das kann hier als Tatsache festgestellt werden, lebt Dr. Susanne Eisenmann nicht – Magister Atrium in…