Anders bei Counter-Strike. Hier zahlt man zwar einen fixen Betrag, etwas mehr als zwei Euro, für einen "Schlüssel", um eine "Waffenkiste" zu öffnen, aus der man dann einen zufälligen Skin erhält. Ein bisschen wie vor dem Spielautomaten: Schaubilder von den enthaltenen Skins rollen blitzschnell, dann immer langsamer über den Bildschirm, bis der digitale einarmige Bandit schließlich zum Stillstand kommt und den "gewonnenen" Skin präsentiert. Die sind natürlich meist weniger wert als der gezahlte Betrag für den Schlüssel. Wie im Casino gewinnt die Bank meistens, in diesem Fall die Entwicklerfirma Valve.
Die Skins selbst sind aber handelbare Objekte. Heißt: Einerseits können sie auf dem Markt der Spieleplattform gekauft oder verkauft werden, Valve kassiert dabei ein paar Prozent Provision. Der Erlös wird den Spieler:innen als Guthaben auf der Plattform gutgeschrieben, mit dem sie wiederum nur Spiele oder eben Skins kaufen können. Eine Auszahlung ist nicht möglich. Aber: Die Skins können auch an Accounts anderer Spieler:innen versendet werden, im Tausch gegen andere Skins oder – in privater Absprache und mit einem Vertrauensvorschuss – gegen Geld. Diese Funktion ebnete den Weg für einen riesigen Markt mit digitalen Gegenständen. Schon bald nach dem Update 2013 entstanden Drittplattformen als Tausch- beziehungsweise Handelsbörse von Counter-Strike-Skins, die aussehen wie Ebay für bunte Waffen. Wer einen virtuellen Skin verkauft, bekommt also echtes Geld aufs Konto. An den Provisionen der Verkäufe verdienen sich die Betreiber dumm und dämlich.
Skins als Geldanlage
Ein bisschen hat es das Feeling von digitalem Briefmarkensammeln: Manche Skins sind sehr selten oder inzwischen über zehn Jahre alt und kaum mehr zu bekommen, sie haben deshalb den Charakter von Sammlerstücken. Von manchen Spielern hört man deshalb auch Sätze wie: "Wäre der Skin nicht so teuer, würde ich ihn wahrscheinlich nicht spielen." Sie sind nicht nur Schmuck, sondern zum Statussymbol der Spieler:innen avanciert. Und die Preise für manche Skins steigen auf teils absurd hohe Summen. 1,5 Millionen Dollar – so viel hätte jemand gezahlt für einen einzigen Skin, für Einsen und Nullen auf irgendwelchen Servern, die im Spiel dann ein klauenförmiges, blau leuchtendes asiatisches Karambit-Messer darstellen. Der Eigentümer trägt den Spielernamen "青い王", Spielerprofil und Inventar sind allerdings privat, was er besitzt, ist nicht zu prüfen. Aber er veröffentlichte in den vergangenen Jahren Screenshots von sehr teuren Skins in seinem Inventar, einer aus dem Jahr 2017 zeigt eben jenes blau schimmernde Karambit. Ob er es wirklich noch besitzt, weiß niemand so genau, Berichte über einen Verkauf gibt es nicht. Was aber bekannt ist: Das Angebot von 1,5 Millionen Dollar lehnte er ab – es war ihm zu niedrig.
Doch Skins eignen sich nicht nur, um sein Vermögen in der digitalen Welt zur Schau zu stellen, sondern auch, um es zu vergrößern. Vor allem sind es die Waffenkisten, mit denen die Skins generiert werden, die zu Spekulationsobjekten werden. Die Kiste mit Namen "Breakout" wurde im Januar 2020 auf dem Markt der Spieleplattform für etwa 30 Cent pro Stück gehandelt. Im Januar dieses Jahres betrug der Preis dann schon über sieben Euro, inzwischen ist er sogar auf über zwölf Euro geklettert. Der Wert ist also in fünfeinhalb Jahren um das Vierzigfache gestiegen. Glücklich dürfen sich all jene schätzen, die vor Jahren diese Entwicklung erkannt und Hunderte oder Tausende Kisten zum Centpreis gekauft haben.
Bootcamp und Sponsoren
Skins sind aber längst nicht der einzige monetäre Aspekt rund um das Videospiel. Inzwischen ist das Counter-Strike-Spielen zum Beruf geworden. Mit dem Videospiel entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten nämlich auch die Kultur darum. Aus anfänglichen "Clans", in denen sich Spieler:innen zusammenschlossen, entwickelten sich professionelle Teams, nicht nur bei Counter-Strike. E-Sports, elektronischer Sport, nennt sich das, wenn Teams auf einer Bühne vor einem Publikum gegeneinander antreten.
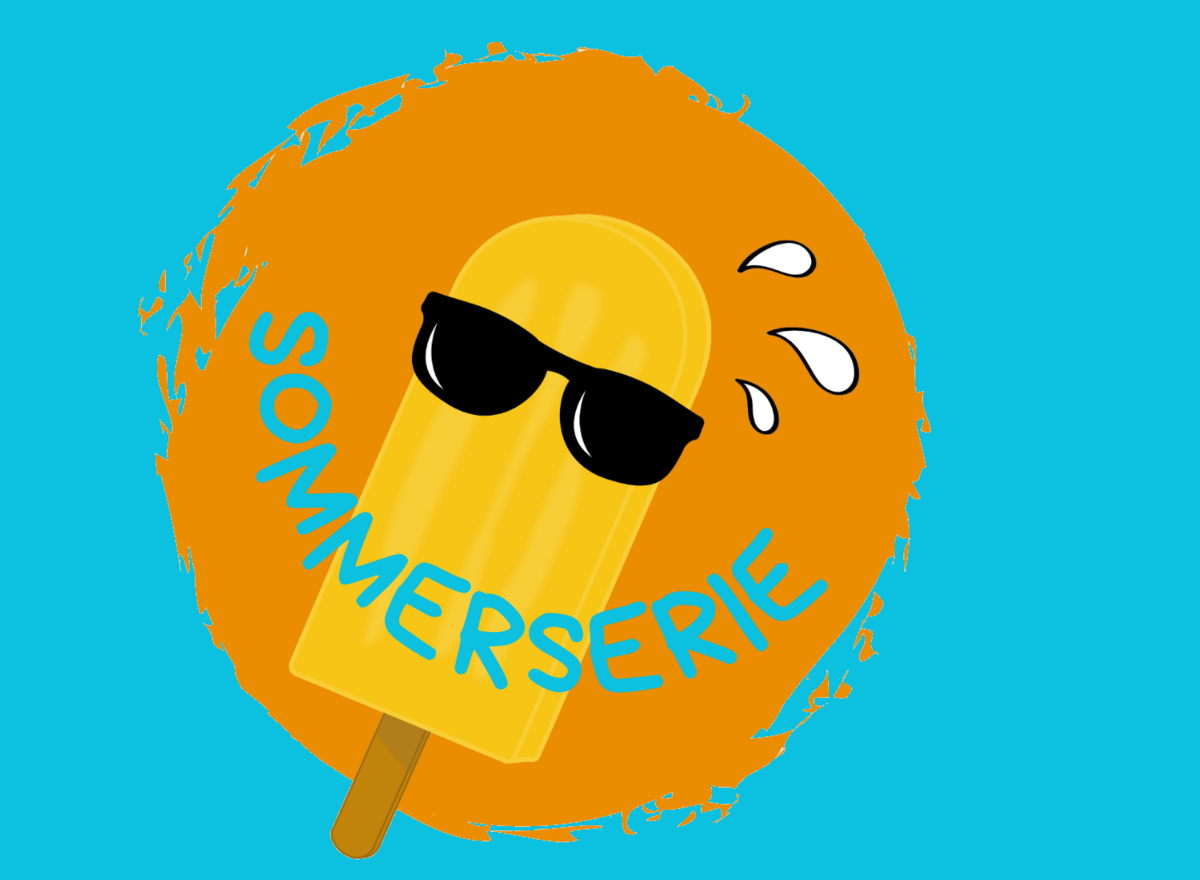












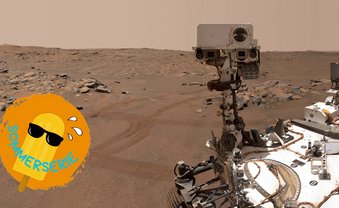




0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!