Wie klingt eigentlich ein Baum? Wie hört sich Erde an oder ein Teich? Ausgestattet mit Kontaktmikrofonen, Sensormikrofonen, Geofonen (Erdsensoren) und Hydrofonen (Wassermikrofonen), zieht ein kleiner Trupp während des Neue-Musik-Festivals "Der Sommer in Stuttgart" in den Wald. Die Komponistin Kirsten Reese will die Klänge des Waldes zu einem musikalischen Werk mit Instrumentalensemble verarbeiten, das auf dem nächsten Eclat-Festival im kommenden Jahr uraufgeführt werden soll. Sie arbeitet dabei auch mit der Ökoakustikerin Sandra Müller von der Universität Freiburg zusammen.
Wie klingt der Wald so unter die Lupe genommen? Auf den ersten Blick ist das Ergebnis wenig überraschend: Am deutlichsten treten Vogelstimmen hervor, der Wind rauscht in den Bäumen, Regentropfen fallen auf die Blätter. Selbst in der abgelegenen Mähderklinge zwischen den Stuttgarter Stadtteilen Botnang und Feuerbach sind daneben auch Autos, Propeller- und Düsenflugzeuge zu hören. Dazu kommt, was ohne die Technik nicht wahrnehmbar wäre: das Krabbeln von Käfern, Töne, die diese von sich geben, Erdbewegungen und bei verringerter Abspielgeschwindigkeit auch Fledermäuse.
Die Ökoakustik versucht, aus solchen Aufnahmen Erkenntnisse über den Zustand der Wälder zu gewinnen. Im längerfristigen Vergleich kann etwa die Intensität des Vogelgesangs abnehmen, was wiederum auf Insektensterben oder Klimawandel zurückzuführen ist. Erkennbar ist aber auch, dass im Wald alles mit allem vernetzt ist. Vögel markieren durch den Gesang ihr Revier, um Nahrungskonkurrenz zu vermeiden. Tiere und Pflanzen reagieren auf Wetterumschwünge oder Gefahren.

















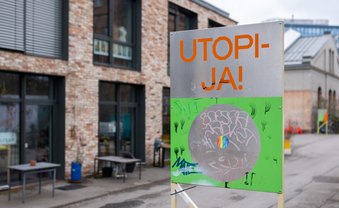








0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!