Denn die Geschichte hält ganz unterschiedliche Lektionen für Aggressor und Opfer bereit. Das deutsche "Nie wieder Krieg" kann ernsthaft nur gemeint sein als Versprechen der Täternation Deutschland, nie wieder ihre Nachbarn mit Waffengewalt zu überfallen. In Kreisen der Friedensbewegung wird die Losung jedoch oft verallgemeinert oder verabsolutiert als ein "Nie wieder" zu jeder Form von militärischer Gewalt, auch defensiver. Das hieße ja auch von den Nationen, die wie die Ukraine im Zweiten Weltkrieg Opfer der NS- Terrors wurden, Gewaltverzicht zu verlangen – selbst im Falle eines Angriffs. Und das auch noch im Namen der Geschichte, in der Juden und Osteuropäer mit dem Preis der Vernichtung dafür bezahlen mussten, dass sie der Mordmaschine der Nazis wehrlos ausgesetzt waren, auch als die militärischen Kampfhandlungen beendet waren. Für die späteren Warschauer Pakt-Staaten ging selbst der Sieg über die Nazis einher mit erneuter Besatzung und Terror. Ihre Lehre aus Krieg und Nachkriegsgeschichte ist "Nie wieder wehrlos". Daher auch die ostentative Wehrhaftigkeit und die unversöhnliche Tonlage osteuropäischer Staatschefs gegenüber Putins Russland, die auch auf den Autor dieser Zeilen lange Zeit befremdlich wirkte, wie ein Relikt des Kalten Krieges. Statt zuzuhören, hielten sich allzu viele Sozialdemokraten und friedensbewegte Linke im Westen – einschließlich der "Anstalt" 2014 – für die besseren Russlandversteher und zeichneten gern eine direkte Linie von der Entspannungspolitik der sozialliberalen Ära bis zu Gorbatschows Geschenk der Einheit. Als habe man allein im politischen Dialog die sowjetische Diktatur niedergequatscht.
Geschichte falsch verstanden
Doch die 1970er Jahre halten keine direkte Antwort parat für die 2020er. Erst recht ist "Entspannung" kein Passepartout für jede politische Situation, sonst gerät sie schnell zum Appeasement, das Aggressoren nur zu weiteren Raubzügen ermuntert. Hitler hätte man womöglich 1936 weit unblutiger stoppen können . Am Ende musste die halbe Welt in den Krieg gegen Nazideutschland ziehen und Dutzende Millionen Menschen ihr Leben lassen, um den faschistischen Aggressor mit militärischen Mitteln zu besiegen und Frieden zu schaffen. Doch diese geschichtliche Erfahrung ist in Deutschland auf seltsame Weise stillgelegt. Die banale wie offenkundige historische Wahrheit, dass die deutsche Demokratie allein deshalb existiert, weil die halbe Welt einen blutigen Krieg geführt hatte, wollen manche Friedens-Tauben gar nicht gern hören.
Das Böse militärisch zu besiegen, gilt ihnen als aussichtlos, ist gleichsam tabu: Ob in Syrien, Gaza oder der Ukraine – der militärische Sieg des "Guten", so scheint es, darf sich nie wiederholen. Weil mit Hitler und dem NS-Regime eine eigene Dimension des Bösen in die Welt kam, steht auch jeder Vergleich mit der NS-Geschichte zu Recht unter dem Verdacht, die Nazi-Gräuel zu relativieren. Die Tabuisierung des Nazivergleichs hat jedoch bisweilen den bizarren Effekt, dass auch die Mittel der militärischen Gegenwehr gegen die aggressiven Diktatoren der Gegenwart gleichsam mittabuisiert werden: Weil das Grauen des Putin-Regimes nicht an das der Nazis heranreicht, verbietet sich auch, diesem Bösen wie im Zweiten Weltkrieg mit derselben militärischen Entschlossenheit entgegenzutreten. Oft geht die publizistische Energie weniger dahin, die Opfer vor dem Aggressor, als den Aggressor vor falschen Hitlervergleichen zu schützen.
Überhaupt: Das Denken in Gut und Böse gilt vielen Friedensfreunden als das Böse schlechthin. Es sei der selbstgerechte moralisierende Blick der vermeintlich "Guten", der nicht nur aus (friedlichen) Nachbarn mögliche Kriegsgegner werden lässt, sondern der auch zu einer gefährlichen Radikalisierung internationaler Konflikte beiträgt: Denn der Gute müsse den Bösen vernichten, während mit einem "normalen" Kriegsgegner ein Ausgleich der unterschiedlichen Interessen gefunden werden kann. Die westlichen Militärinterventionen im Namen von Menschenrechten wie in Afghanistan – oder in Jugoslawien sogar außerhalb des Völkerrechts – sind gern zitierte Beispiele für ebenso missglückte wie verlogene neuzeitliche Kreuzzüge des Westens.
Nun haben die USA selbst durch ihre lange Kette von militärischen Interventionen – auch zugunsten von prowestlichen Massenmördern wie Pinochet – viel moralische Legitimität verspielt. Die Kritik daran wird jedoch nicht unwahr, würde man mit derselben Schärfe den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilen. Und doch hat der westliche Interventionismus bzw. Imperialismus spiegelbildlich einen ebenso selbstgerechten Anti-Interventionsmus bzw. Anti-Imperialismus in der Friedensbewegung und auf der Linken hervorgebracht.
Im Namen der "nationalen Souveränität", der "Deeskalation" oder des antikolonialen Kampfes springt man letztlich sogar Schlächtern wie der Hamas bei, verklärt Hussein, Gaddafi, Assad und Milošević zu Opfern des westlichen Werte-Imperialismus. Der Anti-Kriegsprotest konzentriert sich fast ausschließlich auf die westliche Reaktion, während man eine Antwort auf originäre Aggressionen weitgehend schuldig bleibt. Die irakische Besetzung Kuweits und Massaker an den Kurden, der Angriff von Miloševićs Restjugowlawien auf Kroatien, die serbischen Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg samt dem Massaker von Srebrenica, Putins Angriff auf die Ukraine rufen weit weniger Protest hervor als militärische Interventionen des Westens.
Auch die "Anstalt" kritisierte vor allem den Westen
Stattdessen scheint unter Friedensbewegten immer noch zu gelten: Wer Frieden wolle, müsse nicht etwa den Feind bekämpfen, sondern sein Feindbild hinterfragen. So hat man sich als kritischer Zeitgenosse angewöhnt, in jedem Dämon in erster Linie ein Werk der eigenen Dämonisierung zu sehen. Auch die "Anstalt" bediente sich dieser populären linken Figur in ihrer Auseinandersetzung mit dem Feindbild Russland beim Ukrainekonflikt 2014. Das kommt zunächst sympathisch selbstkritisch daher, verschiebt es doch den Fokus von der (selbstgerechten) Kritik des Anderen auf die allseits geachtete Kritik des eigenen Lagers; im Fall der Ukraine von der Kritik an der russische Aggression auf die Kritik des Westens und seines Anteils an dem Konflikt. Und über kaum etwas redet die Linke ja lieber. Wie der Westen die ausgestreckte Hand Putins ausgeschlagen hat, wie die NATO mit ihrer Osterweiterung Russland in die Enge getrieben und seine Sicherheitsinteressen ignoriert hat.
Am Ende steht also die Exkulpation des Aggressors als linke Lektion aus der Geschichte. Und es ist mehr als ein Zufall, dass manche Linke (auch Sozialdemokraten) und Rechte in der Friedens-Frage überraschend ähnlich klingen, dass die Friedenstaube jetzt auch gern bei der AfD flattert. Nirgendwo wird mit größerer Hingabe das Diktum des SPD-Politikers Egon Bahr zitiert: In der Außenpolitik gehe es nie um Werte, sondern nur um Interessen. Aus dem Kampf zwischen Gut und Böse – oder besser zwischen Aggressor und Vertretern des Völkerrechts – wird so ein Kampf zwischen Mächten mit legitimen geopolitischen Interessen.














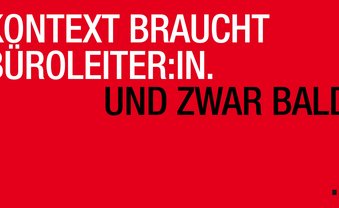


42 Kommentare verfügbar
-
Antworten
Diesen Artikel kann ich in seiner Gänze nur unterschreiben. Bis zum Beginn des Ukraine-Krieges hätte ich mich selbst noch als Pazifistin bezeichnet, denn ich war in den 70er und 80er Jahren auf vielen Friedensdemos unterwegs, und das mit ganzem Herzen. Auch heute wäre mir eine abgerüstete friedliche…
Kommentare anzeigenKatharina Georgi
vor 3 Wochen