Genau das gleiche kann Deutschland jetzt bei der Bundestagswahl erleben. Rechenbeispiel: Bei der Wahl zum Europa-Parlament, für das es keine Sperrklausel gibt, konnten elf Klein- und Kleinstparteien Mandate erringen: BSW (6), FDP (5), Die Linke (3), Volt (3), Freie Wähler (3), Die Partei (2), Tierschutzpartei (1), ÖDP (1), Familie (1) und PdF (1). Unterstellt, die Wahl am Sonntag hat ein ähnliches Ergebnis, und unterstellt, dass die genannten kleinen Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, würden rund ein Viertel (24,5 Prozent) der Sitze unter den großen Parteien verteilt. CDU/CSU und AfD könnten so mehrere Dutzend Mandate kassieren, obwohl die Wählerinnen und Wähler anders abgestimmt hatten.
Sperrminorität
Unwahrscheinlich? Vermutlich, aber nicht ganz. So wurden 2022 im Saarland 22,3 Prozent der Mandate im Landtag anderen Parteien zugeteilt, 1997 bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 19,2 Prozent und 2013 bei der Bundestagswahl 15,7 Prozent. Immer kommen die Stimmen für die kleinen Parteien den großen zugute. Bei der anstehenden Bundestagswahl vermutlich der SPD und den Grünen, aber vor allem CDU/CSU und AfD. Damit ist für die völkische Partei eine Sperrminorität im Bundestag nicht ausgeschlossen.
Bei dem 24,5-Prozent-Beispiel wären nur drei Viertel (75,5 Prozent) der Stimmen im neuen Bundestag abgebildet. Der Rest würde als "Sonstige" abgelegt. Gut für Friedrich Merz: Die Union könnte zusammen mit einem Partner mit nicht einmal 40 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit der Sitze erringen. Denn je mehr Parteien an der Fünf-Prozent-Klausel scheitern, desto weniger Prozentpunkte sind für eine Regierungsmehrheit erforderlich.
"Weimarer Verhältnisse"
Aber halt! Sollte die Fünf-Prozent-Hürde nicht verhindern, dass die Bonner Republik – wie die Weimarer – an ihren vielen Parteien scheitert? Auch auf Kosten des Gleichheitsgrundsatzes, für den Republikaner schon bei der 1848er Revolution gekämpft hatten? Tatsächlich waren im Reichstag bis zu 15 Parteien (1928 und 1930) vertreten, darunter viele, die weniger als fünf Prozent der Stimmen erhalten hatten. Doch daran ist keine der damaligen Regierungen gescheitert.
Auch bei den drei letzten Reichstagswahlen hätte eine Sperrklausel nichts Wesentliches geändert. Bei den zwei Wahlgängen 1932 kamen die Kleinen auf 20 beziehungsweise 24 Mandate (von 604 beziehungsweise 584), bei der Wahl im März 1933 auf 14 (von 566) Mandate, was einem Anteil von 3,5 Prozent entspricht.
Das Ermächtigungsgesetz, dem 444 Abgeordnete zustimmten, hätte auch ohne diese Parteien eine Zweidrittelmehrheit erhalten. Nur die 94 anwesenden SPD-Abgeordneten stimmten dagegen. Mit 81,8 Prozent Zustimmung war die erforderliche Mehrheit leicht erreicht worden. (Die 81 KPD-Mandate waren schon vor der Abstimmung gestrichen worden.)
Ermächtigungsgesetz
Selbst der katholische Zentrumspolitiker Eugen Bolz, langjähriger Staatspräsident in Württemberg, hatte zugestimmt. Genauso Liberale wie der spätere Bundespräsident Theodor Heuss und Reinhold Maier, Baden-Württembergs erster Ministerpräsident. Folge: Die Regierung unter Adolf Hitler konnte Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments beschließen; die Gewaltenteilung war ausgehebelt.
Um dies zu verhindern, so die gängige Erzählung, hätten die "Väter und Mütter des Grundgesetzes" für die Bonner Republik die Fünf-Prozent-Schranke eingeführt. Verschwiegen wird dabei, dass ursprünglich eine viel niedrigere Hürde galt: Eine Partei konnte in den Bundestag einziehen, wenn sie zumindest in einem Bundesland die fünf Prozent erreicht hat. Erst seit 1953 muss eine Partei diese Hürde bundesweit erreichen oder mindestens drei Direktmandate erringen – die sogenannte Grundmandatsklausel. Ein schönes Geschenk für die großen Parteien, die sich seither die Sitze der kleinen untereinander entsprechend ihrem Stimmenanteil aufteilten.





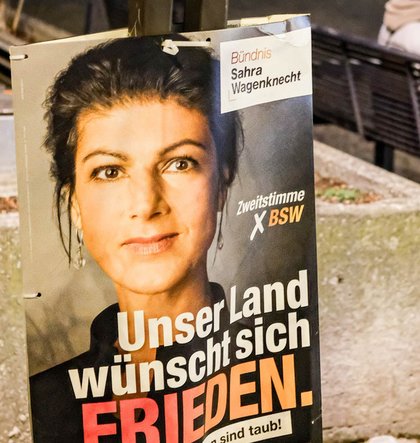







9 Kommentare verfügbar
-
Reply
Ich bemängele schon seit Jahren die 5%-Klausel als extrem undemokratisch, weil dadurch der Grundsatz der Stimmengleichheit nicht mehr gilt: Ob eine (gültig abgegebene!) Stimme zählt oder nicht zählt hängt ab davon, welche Partei man gewählt hat. Das darf nicht sein!
Kommentare anzeigenFranz-Josef
atAlle gültigen Stimmen müssen…