Schon die Überschrift verrät die Tendenz: Ein Lebenswerk, das vom Garagenbetrieb in Stuttgart zur Weltmarke emporwächst, kann nicht schlecht sein. Es klingt nach amerikanischer Erfolgsstory. Ein paar tote und misshandelte Zwangsarbeiter links und rechts des Weges und ein vergessener Mitgründer der Firma Porsche jüdischen Glaubens sind da offenbar zweitrangig.

Ferdinand Porsche, 1940. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-2005-1017-525, CC-BY-SA 3.0
Der angeblich so begnadete und kreative Konstrukteur, wie ihn die Nazis für ihre Herrschaft auch als Vorbild für die Jugend brauchten, erfährt stets mehr Gnade als etwa ein einfacher Handwerker, Buchhalter oder Ingenieur. Bewunderung für den Hightech-Mann von damals auch heute – selbst wenn er und sein Schwiegersohn über Leichen gingen. Der Wiener Anton Piëch war ein glühender Anhänger der Nazis, frühes NSDAP-Mitglied und oberster kaufmännischer Leiter des VW-Werks neben seinem Schwiegervater Porsche. Anwalt Piëch hatte auch keine Skrupel, nach Tausenden von KZ-Häftlingen für die VW-Fabrik zu rufen, um die Menschen bei todbringender Schufterei zu verheizen.
Obwohl die Entwicklung und der Bau des Volkswagens und seiner militärischen Ableger komplett aus dem gestohlenen Vermögen damaliger Gewerkschaften im Rahmen des Freizeitprogramms der sogenannten "Kraft durch Freude" (KdF) finanziert wurde, nehmen Pyta und seine Mitautoren Jutta Braun und Nils Havemann daran wenig Anstoß. Kritikwürdig wäre etwa, dass das "Unternehmen KdF" der NSDAP zugeordnet war, Porsche und Piëch sozusagen im Sold der Nazi-Partei arbeiteten. Was soll's! Auch Nazi-Geld stinkt nicht.
Porsche ist den Nazis in den Hintern gekrochen
Was zählen schon moralische Bedenken im Vergleich zum Bau eines KdF-Wagens samt riesiger Fabrik mitten im Nichts von Niedersachsen? "Das Genie Porsches … habe sich an der souveränen Meisterung der ihm von Hitler selbst übertragenen Aufgabe grandios bewährt – er hat sie mit der ihm eigenen Genialität und Zähigkeit gelöst", zitiert das Autorenteam aus Lobgesängen von Nazi-Größen, als Porsche 1938 der Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft verliehen wurde. "Ideologische Linientreue" sei für diese Auszeichnung "nicht erforderlich" gewesen, behaupten die Historiker. Richtig!
Porsche musste keine SS-Uniform tragen, aber den NS-Führern von Hitler abwärts bei gegebenem Anlass tief in den Hintern kriechen, diese Bräunung erwartete das Regime mindestens von ihm als Dank. Und der angeblich so schöpferische Genius gehorchte und kroch. Zu dieser verbrecherischen Seite nimmt das Autoren-Trio keine analytisch distanzierte Haltung ein. Stattdessen verfällt es zu oft in eine propagandistische Gloriensprache. "Die kreative Zeugung des späteren Erfolgsautos fand mithin in Stuttgart statt …" Häufig findet der Lobgesang hinter Zitaten von Bewunderern im NS-Regime statt. Zum Beispiel diese PR: "Der geniale Konstrukteur ist ein Künstler, der Formen, Beanspruchungen, Vorgänge fühlt … Wer einmal beobachtet hat oder gar im persönlichen Zusammensein miterleben durfte, wie Dr. Porsche technische Dinge anschaut und bedenkt, der steht tief unter dem Eindruck des instinktiven Wirkens eines begnadeten Künstlertums." Was soll ein solches Zitat bei Leserinnen und Lesern bewirken?




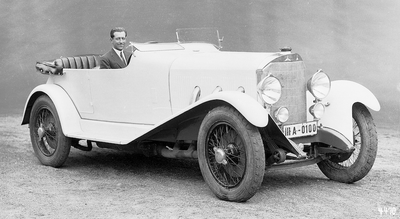







19 Kommentare verfügbar
-
Reply
Ausgerechnet die sogenannten schwäbischen Gutmenschen kritisieren das Verhalten von Porsche. Ihnen sei gesagt: wer mit dem Finger auf andere Menschen deutet, der vergisst sehr leicht, dass drei Finger auf die eigene Person deuten. In diesem Zusammenhang darf ich einmal an den Herrn…
Kommentare anzeigenHelmut Lang
at