Geht doch: Parteien von der Sozialdemokratie über Grüne und Liberale bis zur konservativ-bürgerlichen ÖVP wollen den Autoverkehr in der Wiener Innenstadt alsbald streng reglementieren – und kommen nach der Wahl am vergangenen Sonntag auf 78 von 100 Mandaten im künftigen Gemeinderat. Die SPÖ verlor nur leicht, die ÖVP stark, und die rechtsnationale FPÖ hat sich zwar endgültig vom Niedergang nach dem berüchtigten Ibiza-Video erholt, aber die Spitzenwerte von einst deutlich verpasst. Wie überall in Europa waren am rechtsrechten Flügel Sicherheit und Migration Gewinner. Eher Kreide gefressen hatten dessen Vertreter:innen in Sachen Verkehr, etwa mit Botschaften wie dieser: "Der öffentliche Raum soll so aufgeteilt werden, dass alle Verkehrsteilnehmer, vom Fußgänger bis zum Autofahrer, gleichberechtigt sind, also keine weiteren Fahrverbote."
Genau die jedoch wird es geben, wenn die siegreiche SPÖ (39,4 Prozent) ihre Pläne umsetzt. Den Juniorpartner kann sie sich aussuchen, unter Grünen (14,1 Prozent), den liberalen Neos (9,8) und der ÖVP (9,7). Die Chancen, den Autoverkehr zu reduzieren, stehen gut: Auch die Bundesregierung, bestehend aus ÖVP, SPÖ und Neos, macht den Weg frei für weitgehende Beschränkungen dank einer neuen datenschutzkonformen Kameraüberwachung. 24 weitere österreichische Städte wollen die Möglichkeiten nutzen und ihre Kerne nur noch für Anwohner:innen sowie für ÖPNV, Anlieferungen und die Zufahrt in eine gerade nicht voll ausgelastete Parkgarage offen lassen.
Für die Bundeshauptstadt liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Statt 53.000 Fahrzeuge täglich sollen nur noch 23.000 einfahren und etwa ein Viertel der Parkplätze wegfallen, um den freiwerdenden Raum zwischen Häuserschluchten zur Begrünung zu nutzen. Dass die Verantwortlichen in der Wiener Regierung noch vor dem Wahltag weiterreichende Pläne, etwa zur Schaffung von "unantastbarem Grünraum", vorlegten, spricht für die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.




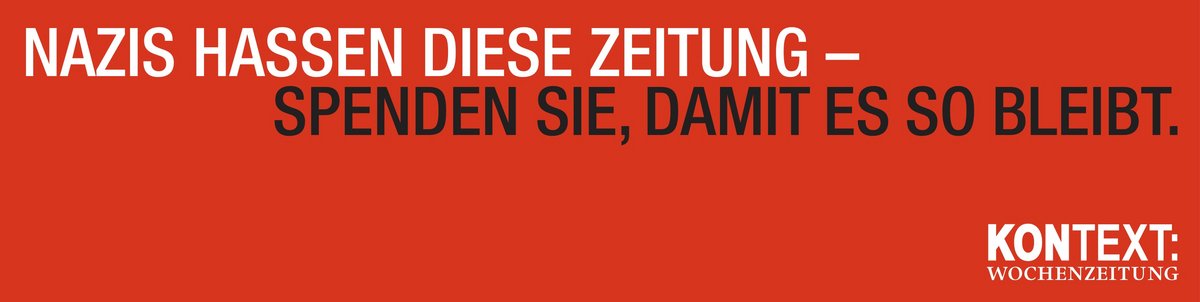
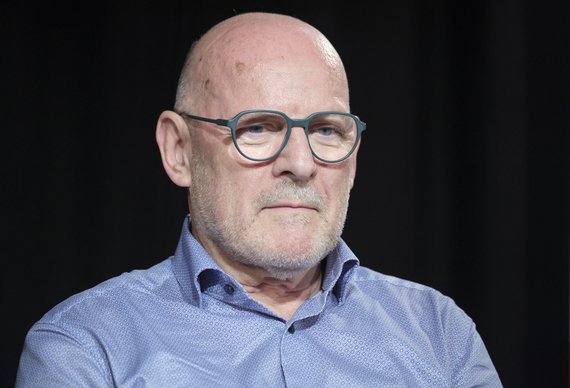




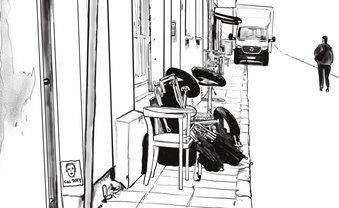
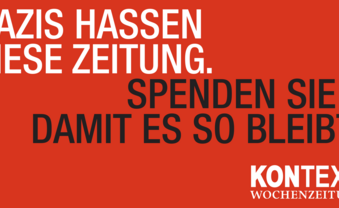


0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!