Drei Generationen leben heute in den Tübinger Wagenburgen. Manche Eltern verließen die Wagenburg und die Kinder kehrten zurück. In der Tübinger Wagenburg leben Lehrer, Sozialpädagogen, Therapeuten, Handwerker, Baumpfleger, ein Diplom-Ingenieur, eine Forstwirtschaftlerin, Rentner, insgesamt rund fünfzig Personen. Neben den Bauwagenbesitzern trifft man auch die sogenannte Lasterszene auf dem Gelände – Menschen, die im ausgebauten Lkw leben. Tom Rau beispielsweise mit seinem MAN 1415f, einem Laster, in dem einst Tauben transportiert wurden, ein rares Modell. Die "Lastwagenleute" sind mobil, mal zu Gast, dann wieder unterwegs, und sie sind weniger geworden. Steigende Benzinpreise, Maut, auch die Vorbehalte fossilen Kraftstoffen gegenüber haben die Szene verkleinert.
Erschlossen ist das Gelände bis heute nicht
"Früher", sagt Jenny Pfeiffer, "war ich auch so unterwegs." Jahrelang, erzählt sie, sei sie mit ihrem damaligen Partner in Spanien umhergezogen. Dann wurde sie Mutter und suchte nach einem Ort, an dem sie bleiben konnte. "In Spanien haben wir gehört, dass es in der Tübinger Wagenburg viele Kinder gebe." Seit 23 Jahren nun lebt sie in der Wagenburg Bambule, ist mittlerweile Großmutter. Sie ist Jugend- und Heimerzieherin, arbeitet in Schichten, muss deshalb mitunter an ihrer Arbeitsstelle übernachten. "Für mich", sagt sie, "ist das ein Riesenunterschied. Wenn ich in einem festen Gebäude schlafe, verliere ich die Nähe zur Umgebung, die ich hier habe. Man setzt sich hier auf ganz andere Weise mit dem Wetter auseinander, ob es nun regnet, ob es schneit."




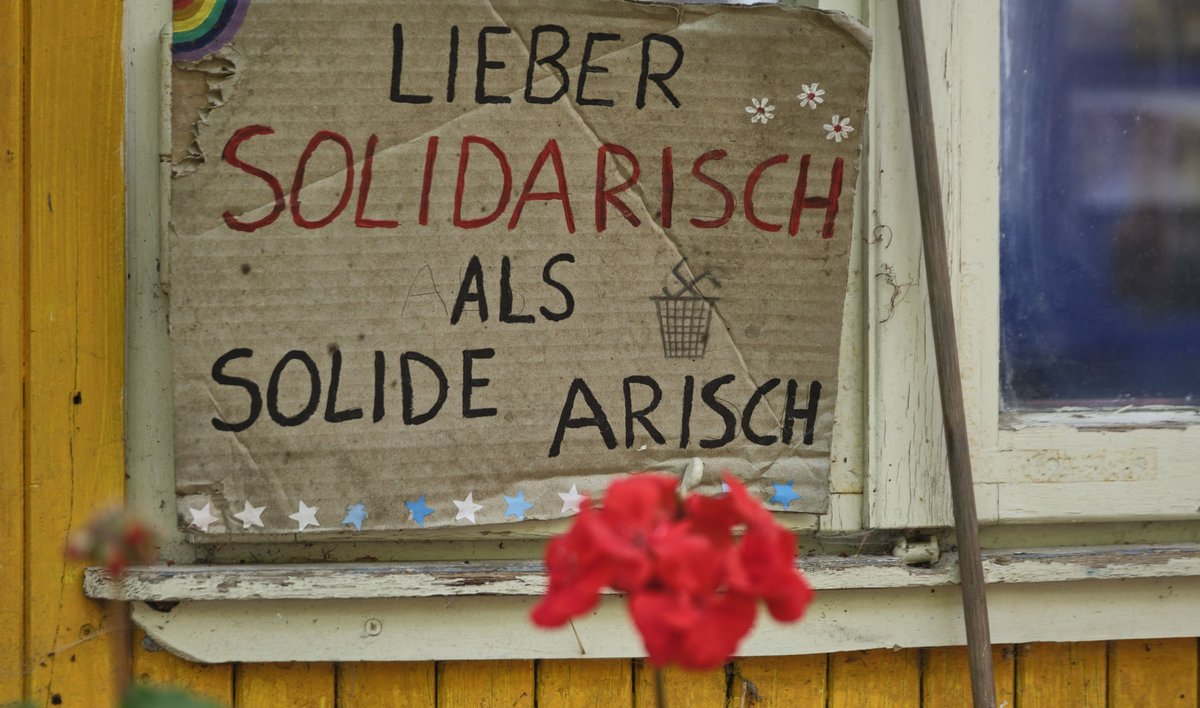


























0 Kommentare verfügbar
Schreiben Sie den ersten Kommentar!